Variantenreiches Üben mit System – das Methoden-Navi für Musiker:innen
Üben ist mehr als Wiederholen. Es ist Forschen, Spielen, Denken – ein bewusstes Gestalten von Klang, Bewegung und Aufmerksamkeit. In der modernen Musikpädagogik rückt dieses Verständnis immer stärker in den Mittelpunkt: weg vom reinen „Fehlerbeseitigen“, hin zu einem variantenreichen Üben, das Lernprozesse aktiv steuert und musikalische Freiheit fördert.
In dieser Episode und im ausführlichen Gespräch mit Geiger und Pädagoge Ulrich Menke erfährst du, wie sich Üben wie ein Trainingssystem aufbauen lässt – strukturiert, kreativ und achtsam zugleich. Sein Ansatz: das Methoden-Navi. Es verbindet klare Übeschritte mit mentalen und körperlichen Strategien, die das eigene Spiel souveräner und gelassener machen.

Menke beschreibt, wie man durch Zeitdehnung, Looping-Techniken und bewusste Routinen den Moment des Übens vertieft – und wie schon kleine sprachliche Veränderungen („Wie kann ich…?“ statt „Das war falsch“) den gesamten Lernprozess positiv beeinflussen.
Das Interview
Vervollständigen Sie folgenden Satz: Üben heißt für Sie…?
Einen Trainingsraum betreten, in dem ich mich mit der schönsten Sprache der Welt auseinandersetze und meine eigenen Ressourcen erweitere – durch die Musikressourcen und im Rahmen der Musik, die ich in der Musikwelt vertrete.
Gibt es aktuell eine Musik oder eine Künstlerin, die bei Ihnen in Dauerschleife läuft?
Ja, ich beschäftige mich gerade mit einer Sonate von Irmel Bonny, einer Französin, Zeitgenossin von César Franck. Das Werk ist chromatisch und rhythmisch heikel. Um mich darin besser einfinden zu können, läuft diese Sonate momentan häufiger.
Wenn Sie auf Ihr eigenes Spiel schauen – gibt es Künstlerinnen oder Künstler, die Sie besonders geprägt haben?
In meiner Jugend waren das Itzhak Perlman als Geiger und Jacqueline Dupré als Cellistin. Beide hatten gesundheitliche Einschränkungen, und mich hat fasziniert, wie sie damit umgegangen sind. Perlmans makelloses Spiel trotz dicker Finger – unglaublich. Und Duprés Musikalität war überwältigend.
Heute ist es eher Augustin Hadelich, den ich unfassbar witzig und spontan finde – sowohl auf der Bühne als auch im Unterricht. Auch er lebt mit einem Handicap, aber er gewinnt durch die Musik enorme Stärke und gibt diese weiter.
Schön – die Kraft der Musik im wahrsten Sinne des Wortes.
Genau.
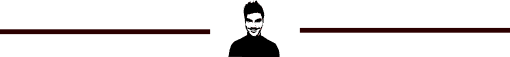

Melde dich für meinen High Five Newsletter an und erhalte 10 Übe-Tipps gratis!
Einmal im Monat nehme ich dich mit hinter die Kulissen meines Podcasts:
- Du erfährst exklusiv, wer meine nächsten Gäste sind.
- Du bekommst praxiserprobte Einblicke in das Thema Üben.
- Du erhältst handverlesene Bücher- und Musiktipps direkt auf dein Handy oder deinen Rechner.
Kurz, kompakt und kostenlos – genau die Inspiration, die du fürs tägliche Üben brauchst.
Nur aktuell: Als Dankeschön erhältst du meine 10 besten Übe-Tipps als kostenloses PDF direkt nach deiner Anmeldung!
Entweder-Oder-Fragen
Um Sie den Zuhörerinnen und Zuhörern noch etwas näher vorzustellen, habe ich ein paar Entweder-oder-Fragen vorbereitet. Sie haben einen Joker – eine Frage dürfen Sie auslassen.
Fußball oder Handball?
Fußball.
Ist das der Grund, woher Ihre Sportfaszination kommt – also die vielen Sportmetaphern im „Methoden-Navi“?
Mich fasziniert, dass allein in Köln alle 14 Tage 50.000 Menschen in einen Chor gehen, einstimmig und sauber singen. Diese Begeisterung und dieser Ritus inspirieren mich sehr für meine musikalische Arbeit.
Das heißt, Sie gehören auch zu diesen 50.000?
Nein, ich selbst nicht. Ich habe zwei sportstudierende Söhne, aber ich bin eher der bewundernde Beobachter.
Wer gewinnt bei Fußball oder Geige?
Geige.
Wenig und oft oder selten und viel?
Wenig und oft.
Struktur oder Intuition?
Intuition.
Abwechslung oder Routine?
Abwechslung.
Reduktion oder Variation?
Variation durch Reduktion.
Leichtigkeit oder Genauigkeit?
Leichtigkeit.
Ruhe oder Gelassenheit?
Gelassenheit.
Achtsam üben – Zeitdehnung als Schlüssel
Sie stellen in Ihrem Buch das Thema Achtsamkeit sehr zentral – zusammen mit dem Sport. Was bedeutet für Sie achtsam zu trainieren oder zu üben?
Zeitdehnung. Ich musste Tempo aus meinem Leben herausnehmen. Ich war ein Effektivitätsmensch, wollte vieles gleichzeitig erledigen. Als ich unabhängig von der Musik Achtsamkeitsübungen und Bodyscans in mein Leben integrierte, merkte ich: Übertrage ich das auf die Musik, halte ich den Türöffner in der Hand.
Diese Zeitdehnung ist wie beim „Slow Motion“-Brief im Sport: Wenn unklar ist, ob ein Foul vorlag, schaut man in Zeitlupe hin. Genau das hilft bei schwierigen Passagen – wenn man nicht weiß, woran etwas liegt.
Darüber sprechen wir später sicher noch ausführlicher – sehr spannend!
Im Vorgespräch haben Sie eine Frage geschickt, die Sie gerne einmal gestellt bekommen würden: „Möchten Sie mitfliegen beim ersten Flug auf reiner Solarbasis?“ Haben Sie gehört, dass gerade ein Schweizer einen neuen Rekord aufgestellt hat?
Ja, ich bin in dem Thema grundsätzlich drin. Ich habe vor Jahren beschlossen, nicht mehr zu fliegen, weil ich es für mich nicht verantworten kann. Die Faszination fürs Fliegen ist aber geblieben – und wenn wir die Energie dafür selbst gewinnen könnten, wäre das die Voraussetzung.
Für alle, die interessiert sind – ich kann den Bericht gerne verlinken: Ein Schweizer flog über fünf Stunden bei rund 9000 Metern Höhe, länger als die Weltumrundung davor. Das hat mich sehr neugierig auf Ihre Frage gemacht.
Einstieg ins Methoden-Navi
Lassen Sie uns ins „Methoden-Navi“ einsteigen. Um ein Gefühl zu geben, worum es geht: Können wir an einem musikalischen Beispiel eine Route durchspielen und Sie erklären, was daran besonders ist?
Gerne. Man könnte mit einem Schüler beginnen, der gerade eine Methode kennengelernt hat. Ich schlage vor, dieser Schüler bekommt die Aufgabe, die Methode im Rollentausch in der nächsten Stunde anzuwenden.
Das heißt, die Aufgabe lautet nicht „Mach die Etüde fertig“, sondern: „Setze eine bestimmte Methode im Üben um“?
Genau. In der Folgestunde zeigt der Schüler nicht das fertige Stück, sondern wie er mit der Methode gearbeitet hat. Wenn dann mehrere Methoden vertraut sind, erkennt er, dass daraus Routen entstehen – abwechslungsreiche Übewege mit unterschiedlichen Sinnen und Parametern.
Beispiel: Dvořák-Sonatine – eine schwierige Passage meistern
Ich nehme eine Stelle aus der Dvořák-Sonatine op. 100, letzter Satz. Eine Passage, bei der viele herausfliegen, weil der erste Takt so schwer ist.
Der Auftrag lautet: Beschäftige dich mit dieser Stelle.
Zuerst geht es um den Fokus – in diesem Fall den Tonraum: Cis-Moll.
Ich spiele das Cis in der Lage, bei Anfängern nur bis zur Terz oder Quinte, ohne Noten. Dann vielleicht im Kanon mit Lehrer oder Eltern – so üben wir Tonraum und Intonation.
Im nächsten Schritt kommt der Rhythmus hinzu: zunächst sprachlich (etwa mit Silben wie „Du-Du-bi-da“ oder „Ja, was geht ab?“), dann mit Air-Bowing-Bewegungen. Schließlich wird der Rhythmus auf die leere Saite und dann auf den Tonraum übertragen – das ist die Methode „Tonraum plus Rhythm First“.
Das Kind merkt gar nicht, dass es den Rhythmus bereits 40 Mal geübt hat.
Slow Motion, Looping und Trainingspartner-App
Dann folgt Slow Motion: Ich nehme die Zeit raus, konzentriere mich auf die Intonation – besonders im ersten Takt, wo der dritte Finger umgreifen muss.
Ich arbeite mit der App Soundcorset, die Slow Motion und Looping kombiniert. Damit kann ich das Tempo allmählich steigern („von 0 auf 180“) – der Schüler bekommt Sicherheit, weil er merkt: Ich kann das Schritt für Schritt schneller machen.
Ich stelle ein: 120 Sekunden Fokus auf diese Stelle – und steigere das Tempo langsam bis zum Original. Der digitale Trainingspartner begleitet mich dabei.
Vom Kofferpacken bis zum Rückspiel
Nun folgt das Kofferpacken – das Wiedereinbauen der Passage in den musikalischen Zusammenhang. Dabei lerne ich sie auswendig und erkenne, wohin die Phrase führt.
Dann kommt das Rückspiel: Ich beginne beim letzten Ton der Passage und arbeite mich rückwärts. Das schafft Vertrauen – ich starte immer in bekanntem Terrain.
Bei Streichern folgt das Auswärtsspiel: Ich spiele die Passage auf einer anderen Saite oder in einer anderen Lage, um neue motorische Reize zu setzen.
Beispielsweise wechsle ich von der E- auf die A-Saite – oder beim Klavier in eine andere Oktave.
Das fordert, stärkt und führt zum Heimspiel, wenn ich zur ursprünglichen Lage zurückkehre. Dann macht es „Klick“ – der Tipping Point ist erreicht.
Ich habe nicht die Stelle gespielt, sondern mit ihr gespielt.
Und das ist das Entscheidende: Diese Sicherheit ist die Grundvoraussetzung für musikalisches Vertrauen – ohne Angst kann Musik wirklich fließen.
Die Besprechung der Methoden-Route
Ja, vielen Dank erstmal. Das war, glaube ich, viel Input für die Zuhörerinnen und Zuhörer und aus dem Grund wollte ich das Ganze auftröseln, weil wir jetzt über viele verschiedene Sachen gesprochen haben. Vielleicht ganz zu Beginn, noch bevor wir das Instrument in die Hand nehmen: Welche Voraussetzungen braucht Ihrer Meinung nach gutes Üben?
Dass ich total viel Lust habe, mich mit einem Instrument auseinanderzusetzen, weil es mich ausmacht, weil es ein Teil von mir ist, weil ich mich mit diesem Instrument identifiziere – und nicht, weil irgendeiner aus der Erwachsenenwelt sagt: „Das musst du mal machen.“ Es muss von vornherein eine Art Liebesbeziehung sein. Das ist die Grundvoraussetzung, damit ich überhaupt intrinsisch motiviert sein kann. Und aus der Liebe heraus entwickelt man dann auch die Sorgfalt. Kinder lieben Rituale. Wenn ich es zu einem Ritual mache, ein Instrument zu öffnen, mich heranzusetzen und mich durch ein Warm-up einzuspielen, wird das etwas, was Kinder unglaublich gern wiederholen. Wie kann ich also Wiederholungen – die im Training notwendig sind – kaschieren? Indem ich sie durch Abwechslung so gestalte, dass man gar nicht merkt, dass ich eigentlich immer in dieselbe Richtung gehe.
Motivation & Ritual: Zwei zentrale Säulen
Ich finde, Sie haben zwei wichtige Sachen angesprochen. Das eine ist diese intrinsische Motivation – die würde ich an dieser Stelle voraussetzen, zumindest bei allen Menschen, die diesen Podcast hören. Das andere ist das Ritual. Sie haben das Ritual beschrieben: den Koffer aufmachen, die Geige rausholen, das Instrument öffnen. In Ihrem Buch haben Sie das schöne Beispiel vom Judo, wo es einen ritualisierten Beginn gibt. Wenn Sie jetzt an Ihre eigene Übe-Biografie denken: Haben Sie ein Ritual gefunden, wie Sie Ihr Üben starten, bevor ein Warm-up losgeht?
Ich starte tatsächlich direkt mit einem Warm-up – wenn man davon absieht, dass ich den Trainingsraum, den ich betrete, nach außen hin abschotte, mich der Medien entledige und dann mit dem Komponisten allein bin, der zu mir spricht. Die Stille als Voraussetzung ist wichtig.
Methodenüberblick: Warm-up, Rhythm First, Looping, Slow Motion, Kofferpacken
Ich würde gern in die Methoden reingehen, die Sie vorher schon angespielt haben. Das waren insgesamt vier Stück. Wir hatten ein Warm-up, wir hatten das…
- Rhythm First
- Kofferpacken
- Looping
- Slow Motion.
Warm-up & Tonraum: Der erste Zugang zur Stelle
Wenn wir vorne mit dem Warm-up anfangen: Da haben Sie den Tonraum dargestellt. Würden Sie sagen, das ist eine praktikable, gute Lösung, um sich einer Stelle zu nähern? Gehen wir davon aus, die Stelle ist vielleicht bekannt – aber das lässt sich übertragen auf Stellen, die nicht bekannt sind, bei einem neuen Stück, das wir zum ersten Mal üben. Ist das eine gute Methode für eine unbefangene erste Annäherung?
Ja, wenn ich weiß, dass mir das Leben dadurch leichter wird. Warum leichter? In einem Chor ist es egal, ob das Stück in D-Dur oder Es-Dur steht – wir singen einfach höher oder tiefer. Bei Streichern ist die Intonation entscheidend abhängig, und bei Pianisten letztlich auch, was die Fingersätze angeht: Was ist der Tonraum in diesem Stück, den ich für diese Passage oder für das gesamte Stück benötige?
Wenn ich etwas herauswerfen kann an anderen Themen, dann würde man vorher mit dem Kind besprechen, was Intelligenz bedeutet. Elisabeth Stern aus Zürich beschreibt Intelligenz als die Kunst des Rauslassens und Außenvorlassens. Wenn ich den Tonraum betreten habe, bin ich in diesem Raum und darf ein zweites Element hinzunehmen. Und das sollte das sein, was das Kind am meisten motiviert. Häufig ist das Rhythm First, weil Rhythmik zusammen mit Ton bereits so viel Musik eröffnet.
Wiederholung ohne Langeweile: Rhythmus als Motor
Genau – man hat dann die erste Möglichkeit, etwas auf eine intuitive Art zu wiederholen, weil ein Rhythmus Wiederholung schon vorgibt.
Ganz genau. Ich brauche die Langeweile, um etwas auseinanderzunehmen – dieses Prinzip würde ich mit dem Kind immer wieder besprechen. Der Musikunterricht ist für mich ein zentraler Unterricht: ein Ort, an dem ich mit wesentlichen Lebensfragen und Strategien konfrontiert werde. Wenn ein Kind lernt: „Wenn du zu viel gleichzeitig willst – das geht nicht. Was kannst du rauswerfen? Wie isolierst du etwas und hast trotzdem Spaß?“ Das soll das Kind selbst überlegen.
Wenn es sagt: „Ich habe erst Spaß, wenn es wirklich viel lauter ist“, dann nehmen wir die Dynamik hinzu. Es sind wie Schalter, die wir zu- und abschalten. Wenn ich merke: „Das ist wieder zu schwer“, nehme ich entweder einen Parameter raus – etwa das Tempo – oder den Tonraum und mache es nur auf leeren Saiten. So wechsle ich, ich changiere – und das Kind merkt gar nicht, wie es sich dauernd um dasselbe dreht.
Werkzeugkoffer statt Ein-Werkzeug-Denken
Wie das Bild vom Werkzeugkoffer, das man gern bemüht: Man nimmt je nach Bedarf neue Tools, um das „Problem“ – in Anführungszeichen – zu lösen und sich mit einer Sache zu beschäftigen. Es gibt das Bild von Abraham Maslow: Wenn man nur einen Hammer hat, sieht man in jedem Nagel das Problem und haut drauf. Je mehr Methoden, desto mehr Werkzeuge habe ich im Koffer und desto mehr Möglichkeiten, mich abwechslungsreich zu beschäftigen. Das finde ich schön, weil es bei Ihnen eine Leichtigkeit hat, die intuitiv wirkt, wenn man bestimmte Sachen dazu- oder abschalten kann.
Wenn wir sagen: Wir haben eine Stelle, mit der wir uns beschäftigen möchten. Wir erkunden zuerst den Tonraum, machen es deutlich langsamer, um uns bewusst zu werden, was da ist, und schalten dann den Rhythmus der Stelle hinzu – daraus wird eine erste schöne Sache, die man mit Dynamik erweitern kann. Und dieses Kofferpacken ist intuitiv: Nach und nach fügt es die Stelle zur Passage zusammen, wie sie im Stück ist, und wieder ins große Ganze – wie ein Puzzleteil, das man herausnimmt, anschaut und am Ende zusammensetzt.
Entscheidend ist die Frage, ob es gelingt, dass das Kind sich mit diesen Werkzeugen nicht nur auskennt, sondern sie auch bezeichnet. Ich habe ein Wording vorgeschlagen, aber ich könnte mir vorstellen, dass ein anderes Kind viel lieber „Lahme Ente“ sagt – dann weiß es sofort: Ich darf jetzt halbes Tempo nehmen. Das Wording sollte zur Herzensangelegenheit des Kindes werden. Es soll entscheiden, wie es seine Methoden nennt.
Methoden benennen, Routen festhalten: Das Übetagebuch
Ich habe im Methoden-Navi einen Zettel entwickelt, auf dem man durch Ankreuzen die Methodenroute kurz festhält. Das darf nicht länger als zehn Sekunden dauern – quasi ein Übetagebuch.
Ich kann dann mit Lehrer oder Lehrerin klar sagen: „Beim Stück Dvořák habe ich am ersten Tag Looping und Slow Motion gemacht; beim zweiten Mal Slow Motion und Kofferpacken.“ – „Dann mach mir das doch mal vor.“
Die Vergewisserung, dass die Kinder wirklich wissen, was im Werkzeugkasten ist, müssen wir erhöhen – nicht unser enormes Wissen oder unsere riesigen Erfahrungen. Vorschläge à la „Üb das doch mal so“ will ich nicht ausschließen, aber weitgehend ersetzen: Kinder sollen Methodenrouten im Unterricht durchexerzieren und überlegen, wie sie der Lehrkraft präsentieren, wie sie die Passage verbessert haben.
Dass es anschließend wieder in Zusammenhänge gebracht werden muss, ist logisch. Ich möchte aber eine Sicherheit im Kind, dass es Alternativen selbst hat und darüber frei entscheiden kann. Das will ich installieren.
Zielbild: Selbstständigkeit im Üben
Ich finde, das ist auch die große Herausforderung – oder für mich das große Ziel im Unterrichten, unabhängig davon, ob das Kinder sind, Erwachsene oder auch das eigene Üben: die Befähigung, dass man sich selbst mit Musik beschäftigen kann. Das sollte das Ziel sein. Niemand möchte ein Leben lang beim gleichen Lehrer bleiben und davon abhängig sein, dass der Lehrer immer erzählt, wie man ein Stück vorbereitet und übt.
Im besten Fall lernt man im Musikunterricht Methoden kennen – wie die heißen, ist am Ende nicht so wichtig – und schafft sich eine Methodenroute, ein Methodennavi, einen Werkzeugkoffer; nennen kann man es, wie man möchte. Entscheidend ist: Man ist befähigt, sich mit Musik zu beschäftigen, weiß, wie man auf Herausforderungen reagiert, sieht darin keine Überforderung, sondern eine Chance zu wachsen und sich zu entwickeln. Das finde ich schön.
Auswärtsspiel & Heimspiel: Passagen variantenreich erschließen
Ich möchte konkret auf eine Sache eingehen, die Sie vorher auch vorgespielt haben und die ich sehr schön fand, weil sie eine spielerische und wichtige Form variantenreichen Übens ist: dieses Auswärtsspiel, zurück zum Heimspiel. Man nimmt bestimmte Passagen und spielt sie auf anderen Saiten, transponiert – das müssen keine Oktaven sein, es kann auch eine halbe Lage höher oder tiefer sein. Man beschäftigt sich damit gedanklich neu und motorisch; diese Sinne sind bei Ihnen wichtig. Dann sind Saiten plötzlich schwerer zu drücken, es entstehen andere Herausforderungen, Blaswiderstände sind anders bei Blasinstrumenten, am Klavier ändern sich Fingersätze: wieder eine motorische Komponente. So kann man mit vielen Tools vier Takte intensiv bearbeiten, richtig?
Ja, genau. Aber ich habe allein – unsere Aufnahme war fast fünf Minuten – und wir haben nur kurz gezeigt, wie das funktioniert. Wenn man das zu Hause macht, ist man locker eine Viertelstunde beschäftigt, ohne die Zeit in den Fokus zu drücken. Man merkt schnell, wie sich die Zeit dehnt – wie ich es vorher beschrieben habe. Das bereitet Freude, weil man sieht, man hat Erfolg mit den Maßnahmen.
Zeitdehnung praktisch: Micro-Sessions aufbauen
Ich würde Schülerinnen und Schüler am Anfang verblüffen und mit der Bitte starten, zunächst nicht länger als fünf Minuten zu üben – damit ein Zeitgefühl entsteht: Was kann ich in fünf Minuten schaffen?
Der Elefant im Raum ist oft unausgesprochen: Kinder haben heute häufig keine Zeit. Um sie wieder heranzuführen, können wir fragen: Was findest du jetzt wichtiger? Oder wir dehnen aus – Zeitdehnung, indem wir sagen: Versuche nur fünf Minuten am Tag zu üben; nächste Woche sechs Minuten und verbinde zwei Methoden. Bei sieben oder acht Minuten sind es drei Methoden.
Wichtig ist ein realistisches, kleines Ziel, das präsentiert werden kann – nicht der pauschale Anspruch „sauberer spielen“.
Sprache formt Handeln: Vom Fehlerlabel zur Handlungssprache
Das Wording ist wichtig – auch für den Unterricht. In meinen Workshops zum Buch trainieren wir konkret, wie wir Sätze wie „zu tief“, „zu schnell“ oder „zu langsam“ vermeiden. Das reine Wiederholen des Fehlers sitzt bei vielen tief und erfordert Training – mit dem Kind.
Es ist nicht nur eine Aufgabe für den Geigenunterricht, sondern grundsätzlich lebenseröffnend, wenn es gelingt, das Ziel mit Worten ins Auge zu fassen und handlungsfähig zu werden. Dazu gehört, im Unterricht die Passagen auszusparen, in denen man ständig wiederholt, was schieflief, und Wörter wie „immer“ und „nie“ zu streichen. Lieber testen: Wie oft geht es wirklich schief? – und messen.
Häufiger mit Aufnahmen arbeiten: den Schüler im Unterricht aufnehmen, zeigen, wie viel Spaß das machen kann. Auf Soundcorsett kann man teilen, per WhatsApp weitergeben. Man kann auch den Tonraum mitgeben: Hier sind die ersten fünf Töne von Cis-Moll; dazu kannst du deinen Kanon in Schleife machen und mitschicken. Wenn der Schüler möchte, schickt er es sogar vorab zurück.
Ich hoffe, Soundcorsett sponsert jetzt die Folge, nachdem wir es so oft erwähnt haben. Mal schauen, was sich machen lässt.
Achtsamkeitsbasiertes Üben
Wir sind jetzt auf einer Metaebene: Die Methoden haben wir vorgestellt und exemplarisch erklärt. Sie haben bereits die erste Metaebene angesprochen. Ich würde noch einmal an den Anfang gehen – zum achtsamen bzw. achtsamkeitsbasierten Üben. Sie nannten vorhin die Zeitausdehnung und in Ihrem Buch außerdem: möglichst viele Sinne ansprechen und den wertfreien Aspekt. Vor allem der wertfreie Aspekt interessiert mich. Die ersten zwei sind greifbar und vermutlich leichter umzusetzen.
Wobei ich da einhaken möchte. Wir arbeiten oft mit dem Begriff sinnvoll. Ich würde auch hier über den Fokus nachdenken: Wie gelingt es dem Kind, einen Sinn bewusst auszuschalten? Einen Sinn einschalten – dass noch einer dazukommt – ist die eine Bewegung; die andere ist ausschalten. Also blind spielen. Oder einen Sinn an die Seite eines anderen stellen: Wenn ich mir ein intensiveres Sehen vorstelle, indem ich „beim Sehen einatme“. Oder den Hörvorgang als Einatmen begreifen.
Dann macht das Kind die Augen zu; beim Öffnen stellt es sich vor, es „trinkt“ das, was es sieht. So entstehen Verbindungen zwischen Sinnen. Das übe ich in der Methode Supervision – eine der fünf Basismethoden am Anfang.
Ablauf: erst Optik (Noten sehen), dann Hören bewusst hineinnehmen; anschließend Noten weg – blind spielen, nur hören; dann kommt das Haptische; ich kann olfaktorische Eindrücke (Geruchssinn) und den Tastsinn hereinnehmen, erspüren, wie die Passage funktioniert. Danach gehe ich wieder heraus und stelle mir vor, wie das Stück klingen soll; dann öffne ich wieder die Augen.
Diese Methode wird in fünf Einzelschritte aufgeteilt – wie ein Bodyscan. Damit halte ich ein Werkzeug, um problematische Stellen gezielt zu bearbeiten. Wenn wir dem Kind klarmachen, wo die Hürde liegt – welcher Parameter Fragezeichen macht –, erleben Kinder Unterricht auf Augenhöhe, nicht nach dem Motto „Augen zu und durch“. Hoffnungsträger reichen nicht; sonst bleiben Elefanten im Raum. Da schließt sich der Kreis: die Befähigung, unabhängig vom Alter, sich selbst beim Spielen zu befähigen – zu wissen, was gefragt ist und was man erreichen möchte.
Das war eine wichtige Ergänzung – vielen Dank.
Wertfreiheit präzisiert: Sowohl-als-auch statt Entweder-oder
Wenn wir auf das „Wertfrei im Üben“ eingehen: Wie gelingt das? Wertfrei heißt nicht, dass ich keine Werte habe, sondern Werte nebeneinander bestehen lasse.
Das gelingt sprachlich, indem ich statt entweder–oder mit dem Kind sowohl–als–auch trainiere – sprachlich wie methodisch. Ich behaupte nicht „Es geht nur in dieser Reihenfolge, wir müssen uns entscheiden“, sondern: Wir könnten es so machen – probiere das aus.
So nehme ich Wertung heraus: Ich sage nicht „Das ist wichtiger als…“. Wertfrei über Musik zu sprechen heißt, Negativbewertungen zu vermeiden („dauernd zu hoch“, „immer derselbe Fehler“). Wir trainieren das nicht nur bei uns, sondern mit dem Kind: das Sprachvermögen ausbauen, in allen Lebensbereichen Werte herausnehmen, damit sie Stellen nicht zur Baustelle machen und negative Erlebnisse erzeugen. Wertfreiheit meint also nicht, keine Werte zu haben, sondern sie bewusst an die Seite der Passage zu stellen.
Selbstüben ohne Selbstabwertung
Was ist, wenn wir den Unterricht mit Kindern verlassen und auf unser eigenes Üben schauen – und dort wertfrei mit uns interagieren möchten? Ich frage bewusst provokant: Wenn ich beim Üben höre, ich war zu tief oder zu hoch – also die Intonation war nicht perfekt –, werte ich gedanklich bereits. Wäre das dann ein Aspekt des achtsamkeitsbasierten Übens, der nicht gelungen ist? Welche bessere Herangehensweise empfehlen Sie, um beim eigenen Üben wertfrei zu bleiben?
Wie kann ich höher spielen? – Wenn der Spitzenton des Trompeters, das c‴, noch nicht funktioniert, benennt das Kind mit „zu tief“ oder „komme nicht hoch genug“ nur negative Barrieren. Frage ich direkt: Wie kann ich…? Was muss ich tun, damit…? – dann entsteht Handlungssprache statt Fehlerlabel. Das gilt über die Musik hinaus.
Es geht also um ein proaktives Wording, das ins Tun führt – nicht um das erneute Benennen des Fehlers. Das ist Ihr Punkt.
Ganz genau.
Trainingsarchitektur: Zirkeltraining
Okay, das war wichtig. Jetzt ist das Ganze ja so aufgebaut – ich glaube, der Begriff Zirkeltraining kommt sogar von Ihnen; das fand ich schön, wobei Zirkeltraining bei mir negative Assoziationen von Frühsport hat.
Vermutlich – bei mir übrigens auch. Ich erinnere mich an den Barren, über den man sich drüberschwingen muss.
Vom Sportbild zum methodischen Wechsel
Bei mir ist es Kugelstoßen.
Aha. Auf jeden Fall: Man weiß sehr genau den Punkt, an dem man Schiss hatte – auf Deutsch gesagt. Und wie kann ich den ausbauen? Und darüber mit dem Kind reden: Welches Zirkeltraining würdest du gerne aufbauen? Wenn dann immer eine Übung weggelassen wird, kann man besprechen, warum das der Fall ist.
Ich finde diesen Begriff sehr schön. Und die Analogie mit dem Sport passt. Die Verknüpfung von Sport und Musik ist nicht neu. Würden Sie sagen, dass sich die Musik noch viel mehr vom Sport abgucken sollte – vor allem beim methodenbasierten Üben oder Trainieren? Das Wort Training sagt ja schon: Da wird an einer bestimmten Sache gezogen, ein Gegenstand in eine Richtung gebracht, während Üben pauschaler klingt. Der Trainingsalltag im Sport ist durch häufigen, regelmäßigen Methodenwechsel geprägt. Diese Anstrengung wird nicht als lästig, sondern als Herausforderung wahrgenommen. Wie schaffen wir es, bei Musikerinnen und Musikern diese Anstrengungsnotwendigkeit zu installieren? Man kann nicht einfach sagen: „Streng dich mal an.“ Wie fordern wir so, dass man zum Beispiel gegen die Uhr spielt – möglichst viele Töne oder Takte in einer bestimmten Zeit? Wenn der Anreiz fehlt, könnte man eine Zeituhr aufstellen – über Soundkorsett möglich. Mir ist wichtig, dass Kinder wissen, wie diese Übungen heißen und davon erzählen. Im Sport hat man oft eineinhalb Stunden Training – so lange arbeiten die wenigsten Studierenden. Es geht um zehn Minuten oder eine halbe Stunde, je nach Alter. Ich behaupte: Ein Ablauf in bewährter Reihenfolge wird attraktiv, sobald die Begriffe emotional werden – „meine Methode“, vielleicht sogar selbst benannt.
Das Wort Training sagt schon, dass etwas ausgerichtet wird. Im Sport ist der Wechsel von Methoden normal – und die Anstrengung wird als Herausforderung erlebt. In der Musik will ich Anstrengungsnotwendigkeit installieren, aber nicht über Appelle. Also gegen die Uhr spielen: möglichst viele Töne/Takte in begrenzter Zeit. Wenn der Anreiz fehlt: eine Zeituhr hinstellen – ja, Soundkorsett kann das. Und ich möchte, dass Kinder wissen, wie die Übungen heißen, und es erzählen. Es geht nicht um 90 Minuten, sondern um 10–30 Minuten sinnvoll gefüllter Zeit. Ein bewährter Ablauf wird dann „ihr Ding“ – besonders, wenn sie Methoden selbst benennen: Nicht „Slow Motion“, sondern ihr eigener Begriff.
Gruppendynamik, Überschneidungsraum & „Auftritt!“
Kommt die Faszination am Sport nicht vor allem von der Gruppendynamik und der sozialen Komponente? Kinder und Erwachsene gehen gern zur Vereins- oder Bandprobe – zwei Stunden Musik: trainieren, üben, proben. Schielen wir als Musiker so gern zum Sport, weil dort das Methodenverständnis ausgeprägter ist? Im Weitsprung käme niemand auf die Idee, den ganzen Tag nur Weitsprung zu üben – man seziert die Bewegung, perfektioniert Teile und baut sie zusammen. In der Musik neigt man eher dazu, „auf Teufel komm raus“ zu üben – mit falschem Ehrgeiz, immer am Gleichen, ohne das Problem zu erkennen und das richtige Werkzeug zu wählen. Ist das nicht der Knackpunkt?
Zur Gruppe zurück: Wir sollten Gruppensituationen so oft wie möglich herstellen. Auch im Einzelunterricht öffne ich den Überschneidungsraum als Ermöglichungsraum: Bitte komm fünf Minuten früher, du bleibst fünf Minuten länger. So entsteht Zusammenspiel – es muss kein gemeinsames Stück sein; eine Kanon-Übung reicht. Sofort entsteht eine andere Dynamik fürs Eigentraining, die Angst vor dem nächsten Auftritt sinkt. Meine letzte Methode heißt „Auftritt!“ – mit Ausrufezeichen. Den Stress rufe ich vorher auf: alle Baustellen, alle Ausreden („zu schnell“, „zu dunkel“, „zu heiß“) werden trainiert. Überliefert ist, dass Pablo Casals mit nassen Fingern geübt hat, weil er schwitzte.
Ich sehe große Möglichkeiten, beidseitig zu profitieren – in der Lehrer–Schüler-Beziehung und im eigenen Üben. Begriffe werden vertraut, und man fragt sich: Welche Methode habe ich lange nicht ausprobiert? Je nach Tagesform umkreist man das Standbild von einer anderen Seite. Mein Wunsch: ein Schlüsselbund, bei dem das Kind in jeder Stunde einen Schlüssel mehr bekommt, um selbst aufzuschließen. Nicht, weil die Lehrkraft sagt: „Wichtige Methode“, sondern weil sie entlastet: etwas rauswerfen, um sich konzentrieren zu können.
Ich hätte, um den Themenkomplex Üben abzuschließen, noch eine Frage zu Ihrem Üben und Ihrem Verhältnis zum Instrument. In meinem Podcast dürfen vorherige Gäste, ohne zu wissen, wer kommt, eine Frage stellen. Die Singer-Songwriterin Winter hat gefragt: Wie war die Beziehung zwischen der Geige und dem Instrument?
Ich habe als Sechsjähriger mit der Geige angefangen. Sie war etwas Empfindliches: Man musste unglaublich gut aufpassen, keine Kratzer, Bogen richtig spannen. Das erzeugte Distanz. Keine gute Voraussetzung, ein Instrument heiß und innig zu lieben.
Heute ist die Beziehung intensiv, weil ich gezielt herangehe: Wo sind die Stärken? – bestimmte Saite, bestimmte Lage. Und ich weiß: Jede Geige, auch eine Stradivari, hat klare Schwächen – einen Ton mit eigener Resonanz. Nicht beklagen: „Das geht da oben nicht“, sondern fragen: Wie kann ich es dort machen? Wie bereite ich mich vor, damit ich mich wohlfühle? Also wieder Problemlösung, nicht Problembennenung. Ich habe das Instrument kennengelernt, indem ich es ausgereizt habe – täglich.
Das Ausreizen hat dazu geführt, dass aus der distanzierten Beziehung Liebe wurde.
Genau – und zu sehen: Alte Instrumente haben Katschen; die gehören zum Leben.
Was heißt Ausreizen? Nicht an Grenzen denken, sondern einen Schritt weiter gehen. Gern kurze Aufnahmen machen, kontrollieren, dass ich einen Ton nicht zerdrücke oder einen Säusler nicht zu leise gestalte. Wie im Zusammenleben mit Menschen: gegenseitig verstärken. Mein Bild vom Training: Meine Ressourcen und die Ressourcen der Musik verstärken sich gegenseitig – so begegne ich dem Instrument.
Das ist ein schönes Bild. Zum Abschluss zwei Fragen, die ich allen Gästen stelle: Was lernen oder üben Sie gerade, was Sie noch nicht so gut können – gern auch nicht-musikalisch?
Im Grunde die drei letzten Methoden, die in meinem Unterricht zu selten vorkamen: Vom-Blatt-Spiel, Improvisation und Filmmusik. Da kommt Fantasie hinein, und ich wage eigene Improvisationen – nicht pauschal „Denk dir was aus“, sondern angeleitet. Schrittweise: Gegensätze – schwarz/weiß, in Erinnerung an blau, salzig/süß. Also mit Gegensätzen in einem Sinneszusammenhang arbeiten – den passenden Sinn treffen, der für das Kind gerade vorne ist, und darüber Zwischentöne einführen.
Und wenn Sie an Ihr jüngeres Ich als Erstsemester Musik denken: Welchen Tipp würden Sie heute geben?
Breit aufstellen. Wagen, etwas Neues zu beginnen – ich habe erst jetzt mit dem Akkordeon angefangen. Gitarre, Schlagzeug – kurz hineingehen, Wochen, Monate, ein Semester. Verschiedene Stile probieren, Vielfalt zulassen. Studierende fürchten oft, sich zu verzetteln. Aber die Ressource entsteht durch Breite, die ich am Hauptinstrument anwende: Klangerfahrungen und Literatur kommen dort direkt zugute.
Also: Offenheit – den Horizont weit halten.
Offenheit und den Horizont weit halten. Wir haben im täglichen Training einen kleinen Ausschnitt. Gleichzeitig strömt zweidimensionale Vielfalt über Medien auf uns ein. Tiefe entsteht nicht durch noch mehr Vielfalt, sondern durch Begreifen – Tun. Begreifen heißt: Instrument in die Hand. Dann merke ich, wie heikel die Gitarre aus Geigersicht ist oder wie viele Tasten ein Klavier hat. Das führt zu neuer Demut am eigenen Instrument.
Wer schreibt hier eigentlich..?
Patrick Hinsberger studierte Jazz Trompete bei Matthieu Michel und Bert Joris und schloss sein Studium im Sommer 2020 an der Hochschule der Künste in Bern (Schweiz) ab.
Seit seiner Bachelor-Arbeit beschäftigt er sich intensiv mit dem Thema musikalisches Üben und hostet seit 2021 den Interview-Podcast "Wie übt eigentlich..?"
