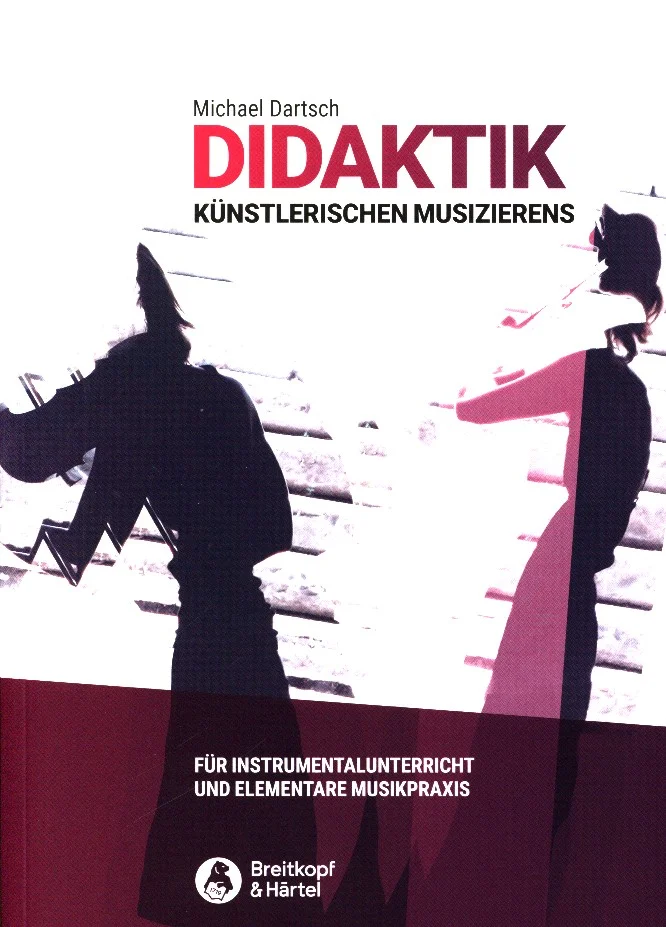In dieser Podcast-Folge sprechen wir mit Prof. Dr. Michael Dartsch über zentrale Fragen der Musikpädagogik: Wie motiviert man Kinder nachhaltig zum Üben? Was macht guten Instrumentalunterricht aus? Und wie können digitale Medien oder neue Lernorte die Zukunft des Musikunterrichts mitgestalten?
Als Professor für Instrumentalpädagogik und Autor der Didaktik des künstlerischen Musizierens bringt Michael Dartsch fundierte Einblicke in die Unterrichtspraxis, differenzierte Übestrategien und pädagogische Grundhaltungen mit. Ob kontemplatives, exploratives oder expressives Üben, ob Elternbeteiligung, Individualisierung oder App-basierter Musikunterricht – dieses Gespräch liefert Impulse für alle, die Musikunterricht menschlich, kreativ und zukunftsorientiert gestalten möchten.


🎧 Jetzt reinhören und erfahren:
- Warum Kinder lieber das spielen, was sie schon können – und wie man das sinnvoll nutzt
- Wie Eltern beim Üben unterstützen, ohne zu kontrollieren
- Warum Tutorials & Videos hilfreich sein können – aber den Präsenzunterricht nicht ersetzen
- Welche vier Übe-Dimensionen künstlerisches Lernen fördern
- Wie Musikschulen sich als moderne Lernorte weiterentwickeln könnten
Lesetipp
In dieser Folge sprechen wir auch über das aktuelle Buch von Michael Dartsch.
Didaktik künstlerischen Musizierens
Michael Dartsch
„Michael Dartsch legt hier eine Didaktik vor, die für künstlerisches Musizieren allgemein und damit sowohl für den Instrumentalunterricht als auch für die Elementare Musikpädagogik Geltung beansprucht. Dabei wird auch der aktuell diskutierten Frage nachgegangen, ob Unterricht künstlerische Prozesse fördern kann oder sie im Gegenteil behindert. Es wird die These entfaltet, dass er künstlerische Entwicklungen begünstigen kann, wenn er sich an bestimmten Grundsätzen orientiert. Damit wird ein Konzept vorgestellt, das als Grundlage für den Unterricht dienen kann.
Nach einer Auseinandersetzung mit Fragen zur Allgemeinen Didaktik sowie zur sozialen und ethischen Dimension des Unterrichts folgt zunächst eine inhaltliche Bestimmung der Fächer Instrumentalunterricht und Elementare Musikpraxis.
Es schließen sich Überlegungen zu Zielen, Inhalten von künstlerischem Musikunterricht und schließlich zu Methoden an. Die Ergebnisse werden im Fachdiskurs verortet.
Eine Reihe von Praxisbeispielen illustriert die Umsetzung der Ergebnisse in der Praxis des Unterrichts. Somit richtet sich das Buch an Studierende und Lehrende gleichermaßen.“
*Wenn du das Buch über diesen Link kaufst, erhalte ich eine kleine Provision (ca. 5 %) – für dich bleibt der Preis gleich. Du unterstützt damit direkt meine Arbeit. Vielen Dank dafür! 🙂
Das Interview mit Michael Dartsch
Die erste Frage, mit der es immer losgeht, lautet: Vervollständigen Sie folgenden Satz. Üben heißt für Sie?
Eine Zeit, in der ich mit mir selbst beschäftigt bin und die mir fehlt, wenn ich sie nicht habe.
Das finde ich sehr schön. Gibt es denn gerade eine Musik bei Ihnen, die in Dauerschleife läuft? Beim Üben oder zu Hause am Radio?
Beides gerne. Beim Üben natürlich die Stücke, die ich im Moment viel spiele – also Dvořák, romantische Stücke für Geige und Klavier. Das habe ich letzte Woche gespielt, spiele ich nächste Woche wieder, und auch nächstes Jahr nochmal. Das übe ich im Moment sehr viel und deswegen höre ich das auch sehr viel.
Gibt es einen Künstler, eine CD vielleicht sogar von jemandem ganz speziell, der Sie auf Ihr Spiel sehr geprägt hat? So eine Art Vorbild vielleicht?
Ich glaube nicht, dass ich sagen könnte, dass es jemanden gibt, der mich als Vorbild, als Geiger sehr geprägt hat. Meine Lehrer haben mich geprägt, aber das sind keine international großen Geiger. Ich kann aber trotzdem ein paar Geiger nennen, die ich top finde in bestimmter Hinsicht.
Mir gefällt Andrew Manze sehr gut. Das ist heutzutage eher ein Dirigent, aber ich kenne noch seine Geigenzeit – oder er geigt ja auch immer noch. Der spielt unheimlich kreativ und in seinen Interpretationen ist unheimlich viel Interessantes und Persönliches.
Was Perfektion und die absolute Beherrschung jeder Nuance von Tongestaltung betrifft, finde ich Hilary Hahn fantastisch.
Und von den großen alten: Michael Rabin – was die Tongestaltung betrifft, hat er so einen wunderbaren Schmelz, den heute irgendwie keiner mehr so spielt.
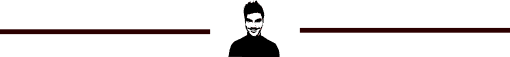

Melde dich für meinen High Five Newsletter an und erhalte 10 Übe-Tipps gratis!
Einmal im Monat nehme ich dich mit hinter die Kulissen meines Podcasts:
- Du erfährst exklusiv, wer meine nächsten Gäste sind.
- Du bekommst praxiserprobte Einblicke in das Thema Üben.
- Du erhältst handverlesene Bücher- und Musiktipps direkt auf dein Handy oder deinen Rechner.
Kurz, kompakt und kostenlos – genau die Inspiration, die du fürs tägliche Üben brauchst.
Nur aktuell: Als Dankeschön erhältst du meine 10 besten Übe-Tipps als kostenloses PDF direkt nach deiner Anmeldung!
Ein Kennenlernen mit Entweder-Oder-Fragen
Und um Sie den Zuhörerinnen und Zuhörern, die Sie noch nicht so gut kennen, ein bisschen näher vorzustellen, habe ich mir ein paar Entweder-Oder-Fragen überlegt. Einen Joker haben Sie – das heißt, Sie können einmal die Antwort verweigern. Auf alle anderen bin ich sehr gespannt, wie Sie sich entscheiden.
Aufstehen oder Snooze?
Aufstehen.
In Gruppen oder Einzelunterricht?
Auf der Geige oder bei Seminaren? Das ist jetzt die Frage. Ja, Gruppe, sage ich mal.
Noten oder keine Noten?
Noten.
Karl Orff oder Edwin Gordon?
Ich würde beiden nicht so zugeneigt sein, aber ich versuche mich trotzdem mal zu entscheiden. Orff.
Beteiligen oder Bestimmen?
Beteiligen.
Langeweile oder Routine?
Routine.
Fragen stellen oder Fragen beantworten?
Fragen stellen.
Bunt oder schwarz-weiß?
Bunt.
Tiere, Aliens und Teddybären: Figuren in Instrumentalschulen
Das ist eigentlich schon ein ganz guter Einstieg in meine erste Frage. Mir ist aufgefallen in der Beschäftigung mit dem Thema – also das Thema ist ja hauptsächlich Instrumentalunterricht für Kinder und Anfänger – dass in vielen Instrumentalschulen Tiere oder Fabelwesen genutzt werden, so als Begleitcharakter. Warum ist das so?
Weil man das mit Kindheit in Verbindung bringt. Diejenigen, die das tun, gehen davon aus, dass das für Kinder attraktiv ist und dass das etwas mit der kindlichen Welt zu tun hat.
Ich persönlich sehe allerdings die Gefahr, dass das von der eigentlichen Motivation abbringt.
Geigenschulen gibt es zum Beispiel mit zwei Affen – Susi und Eddie –, eine mit zwei Aliens, die heißt Castro und Pollux – das sind grüne Marsmenschen –, eine in Bilderbuchform mit einem Teddybären, und eine mit Clown Pippo – Geigen mit Clown Pippo.
Und ich denke mir dann manchmal: Wird das der Ernsthaftigkeit des Ganzen gerecht? Wenn ein Kind wirklich Musik machen möchte, Lieder spielen möchte – braucht es dazu Affen, Clowns, Aliens? Führt das nicht auf Nebengleise?
Das kann schon mal eine nette Motivation sein, aber ich würde das nicht zu wichtig nehmen. Die wichtigste Identifikationsfigur bleibt wahrscheinlich die Lehrperson – oder andere Personen aus der Familie, die ein Instrument spielen und die das Kind zur Identifikation anregen.
Wofür man es gut nutzen kann, ist, wenn man Bilder über einem Lied hat, die eine bestimmte Interpretationsfarbe betonen:
Ein Lämpchen über einem Lied könnte bedeuten, ich spiele das Lied besonders weich. Oder ein schnelles Pferd über einem Lied könnte das Kind animieren, das Lied besonders schwungvoll oder rasend zu spielen.
Das würde ich auch benutzen – aber dann eben für einzelne Lieder. Das sind dann eher sekundäre Merkmale.
Ich habe mir in der Vorbereitung überlegt, dass es ja wahrscheinlich auch mit diesem Trend der Gamification zu tun hat.
Gab es aber schon viel früher. Die ersten Schulen mit Tieren – Susi und Eddie ist eine sehr frühe Schule.
Ich habe erst vor kurzem bei der European String Teachers Association über Geigenschulen gesprochen und da habe ich das Thema auch angesprochen.
Ich glaube, es gibt zwei Sichtweisen auf das Thema.
Entweder: Kinder sollen so ernst genommen werden, dass man ihnen echte Musik und wirkliche Kunst anbietet – nicht irgendwas Kindertümelndes oder scheinbar kindgemäßes. Kinder sollte man nicht in Schutzräume packen und vor anderen Dingen bewahren, sondern sie von Anfang an in die Gesellschaft der Erwachsenen reinnehmen.
Oder: Gott sei Dank verstehen wir heute, wie Kinder ticken, fühlen, lernen – und wir sollen uns immer auf sie einstellen, alles versuchen, in ihre Welt reinzubringen und an ihre Welt anzuknüpfen. Das ist eher die Schiene, Instrumentalunterricht möglichst ganz spielähnlich zu gestalten. Ich denke, die Wahrheit liegt in der Mitte – oder man sollte das Beste aus beiden Welten verbinden.
Es kommt darauf an, dass Kinder etwas spüren von dieser Kunst. Dass man selber Musiker ist, das sollen sie spüren – nicht nur Spielpartner oder Entertainer.
Sie sollen merken: Ich nehme dich mit hinein in dieses Musikersein. Du gehörst dazu. Ich musiziere mit dir von Anfang an. Nicht etwas, woran ich keinen Spaß habe – das würde ich auch nicht gern mit Kindern machen.
Und andererseits natürlich verstehen, dass Kinder sich noch nicht lange konzentrieren können, nicht lange auf Belohnungen warten können.
Sie brauchen in jeder Stunde ein Erfolgserlebnis. Ihre Frustrationstoleranz ist noch nicht groß. Ich darf sie nicht zu hart kritisieren. Das ist vielleicht das Beste aus beiden Welten kombiniert.
Ja, hier können wir gleich noch näher drauf eingehen, auf jeden Fall. Wenn wir jetzt gerade schon feststellen, dass diese Tiere und Fabelwesen ja alle schon relativ lange in den Instrumentalschulen sind und Sie ja auch auf eine recht lange Erfahrung zurückblicken können in dem Bereich Musikpädagogik, was würden Sie denn sagen, wie sich dann die Instrumentalpädagogik für Kinder jetzt speziell in den letzten Jahren entwickelt hat? Und wo geht die eigentlich hin in Zukunft, wenn Gamification dann vielleicht noch nicht so ein krasses Buzzword ist, wie man so denkt?
Ich glaube, sie geht im Moment mehr in die Richtung dieser speziellen für Kinder inszenierten Welt. Die letzten Geigenschulen, „Die schlaue Geigenschule“ ist eine, oder davor „Das Geigenwunderland“ und „Buntes Geigenland“ oder so ähnlich – da sind ganz viele Elefanten und andere Tiere drauf.
Ich glaube, es geht im Moment mehr in diese sehr bunte, vermeintlich kindgemäße Welt.
Altersgerecht und individuell: Pädagogische Feinabstimmung im Unterricht
Und Sie haben es vorher schon angesprochen: Frustrationstoleranz. Wenn Sie sagen, das Beste aus beiden Welten sollte kombiniert werden, dass man als Lehrperson oder Musiker, wie Sie es ja gerade beschrieben haben, mit den entsprechenden Methoden und Werkzeugen ausgestattet ist – dann ist wahrscheinlich eine der größten Hürden im Instrumentalunterricht mit Kindern, das so abwechslungsreich zu gestalten, dass sich Kinder durchgehend… ich muss das Wort „entertain“ sagen, Sie haben es ja gerade eher im negativen Kontext benutzt, aber zumindest nicht langweilen. Da gibt es ja auch Abstufungen: Wenn ich ein fünfjähriges Kind im Vergleich zu einem neunjährigen Kind unterrichte – inwiefern muss man da als Lehrperson auf diese verschiedenen Entwicklungsstufen Rücksicht nehmen im Instrumentalunterricht?
Man muss auf jedes Kind in seiner persönlichen Entwicklung Rücksicht nehmen. Das ist nicht nur das Entwicklungsalter – also Vorschulkind, Grundschulkind – sondern auch das individuelle Kind.
Ein Kind mit fünf kann schon wahnsinnig weit entwickelt sein, während ein anderes mit acht noch nicht so weit ist.
Der Einzelunterricht – Sie haben ja eben auch nach Gruppe und Einzel gefragt – bietet die Chance, dass ich mich sehr individuell auf jedes Kind einstellen kann.
Ich hatte auch schon relativ junge Kinder, die mir gesagt haben: „Ich will richtige Noten haben. Ich will nicht so was Buntes, ich will das, was du hast.“
Das gibt es also auch – dass man das gar nicht unbedingt kindlich gestalten muss.
Noch kurz zum Thema Abwechslung: Sie haben gesagt, das heißt nicht unbedingt Entertainment. Können Sie das noch erläutern?
Dieses mit der Abwechslung heißt für mich nicht, dass ich dem Kind ständig Spaß bieten muss.
Es gibt viele Felder, die man im Instrumentalunterricht sinnvollerweise unterbringt – das ist nicht nur das Stehen vor dem Notenständer.
Ich würde niemals ein sechsjähriges Kind 30 Minuten vor den Ständer stellen. Dann baut sich Unruhe auf, und irgendwann kann es das Instrument nicht mehr halten.
Wir können vieles im Sitzen machen.
Wir können singen, Body Percussion einbeziehen, uns über Musik oder Komponisten unterhalten. Wir können ein Arbeitsblatt anmalen oder spielerisch Fingersätze entdecken. Wir können Hörübungen machen.
Das alles ist für mich kein Entertainment, sondern ein Wechsel der Aktionsweise und des Inhaltsfeldes. Dadurch wird der Unterricht automatisch abwechslungsreicher.
Bausteine einer gelungenen Unterrichtsstunde
Das sind dann eigentlich schon ganz konkrete Bausteine, wie sich Instrumentalunterricht aufbauen kann. Was für wichtige Bausteine würden Sie sagen hat denn Instrumentalunterricht mit Kindern? Wie sähe eine perfekte Stunde aus – wenn man das mal so ganz platt sagen möchte?
Das kann man sicher nicht allgemein sagen, aber natürlich: viel Zeit am Instrument – das ist auf jeden Fall wichtig.
Ich möchte nicht, dass jemand denkt, man spielt fünf Minuten Geige, dann fünf Minuten singen, fünf Minuten ausmalen, fünf Minuten reden – und am Ende hat man nur fünf Minuten Geige gespielt.
Ich denke schon: viel Zeit mit dem Instrument, aber eben in verschiedenen Positionen – stehend, sitzend oder auch mit der Geige am Boden, wenn wir zum Beispiel zupfen.
Für den Anfangsunterricht würde ich folgende Bereiche nennen:
1. Rhythmusarbeit
Zum Beispiel bei der Geige auf leeren Saiten. Oder bei anderen Instrumenten auf dem Ton, den man schon erzeugen kann – auch Klappengeräusche oder Blasgeräusche.
Dazu gehören Übungen wie Rhythmen vor- und nachspielen, Frage-Antwort-Spiele, kleine Verse, Namen oder Tiere rhythmisch nachspielen – zum Beispiel:
Ameise, Ameise, Fliege, Fliege, Wurm, Fliege, Ameise, Wurm.
2. Singen
Singen halte ich für sinnvoll in fast jedem Unterricht – besonders bei Melodieinstrumenten wie Geige oder Klavier.
Nicht nur wegen Intonation, Atmung oder Phrasierung, sondern um eine innere Vorstellung von den Liedern zu entwickeln.
Damit ich sie wirklich „in mir drin“ habe und nicht von Noten „abbuchstabiere“.
3. Notenlesen
Das ist natürlich ein wichtiger Bestandteil – vielleicht nicht in den allerersten Stunden, aber nach ein paar Monaten kommt es dazu.
Ich würde sagen: Es läuft parallel. Musizieren sollte weiterhin aus der eigenen inneren Vorstellung gespeist werden.
4. Auswendig spielen
Das spielt ebenfalls eine große Rolle – nicht alles nach Noten, sondern auch nach Gehör und innerem Bild.
5. Körperübungen
Gerade beim Geigespielen ist das wichtig – was die Hände und Arme tun, sind oft ungewohnte Bewegungen.
Lockerungsübungen wie Arme wie bei einer Marionette hochziehen und fallen lassen, Schultern werfen und lockern – das ist alles Bestandteil des Unterrichts.
Diese Übungen können spielerisch verpackt sein.
6. Gespräch über Üben zu Hause
Mit Kindern und Eltern gemeinsam überlegen: Wie entwickelt man eine Routine?
Wie mache ich das Instrument bereit? Was kann ich nächste Woche tun?
Anfangs vielleicht zupfen, dann später Bogenübungen. Immer wieder besprechen, was sinnvoll wäre.
So entwickelt sich über die Jahre eine Übetechnik.
7. Sprechen über Musik
Vielleicht nicht von Anfang an über Komponisten – da spielen wir oft noch keine klassischen Stücke.
Aber über den Aufbau eines Stücks sprechen: Wiederholungen erkennen, Kanons entdecken, zweite Stimmen vergleichen.
So bekommt das Kind ein Gefühl für musikalische Strukturen.
Jetzt hatten Sie vorher bei den Entweder-Oder-Fragen, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, auf die Notenfrage geantwortet – Noten oder keine Noten – mit „Noten“. Das heißt, wenn Sie sagen, auswendig spielen ist irgendwann ein wichtiger Punkt, beziehungsweise am Anfang… Das heißt, Sie versuchen dann nicht zwangsläufig – wir hatten das Rhythmus-Ding mit diesen Ameisen, Fliegen und Würmern – das kann dann auch theoretisch ganz ohne Noten passieren?
Das kann ohne Noten passieren. Ich habe auf die Frage so geantwortet, weil ich sie so verstanden habe, dass es darum ging, ob ich beim Musizieren eher mit oder ohne Noten auf der Bühne stehe. Ich improvisiere auch gerne, aber wenn ich konzertiere, dann in der Regel mit Noten. Ich habe auch schon mal ohne gespielt, auch mit Jazzmusikern zusammen.
Aber im Unterricht finde ich, kann vieles ohne Noten stattfinden.
Wenn wir zum Beispiel mit den Rhythmusspielen Ameise, Fliege und Wurm arbeiten, können wir bald anfangen zu überlegen: Wie merken wir uns die Reihenfolge, damit du sie zu Hause wiederholen kannst?
Wie können wir das aufmalen oder aufschreiben? Vielleicht sagt das Kind: „Dann male ich eine Ameise, dann zwei Fliegen, dann einen Wurm.“ Das ist aber anstrengend – bis man eine Fliege gemalt hat, dauert es.
Dann sage ich: Es gibt einen Trick. Wir haben eine Sprache dafür.
Man kann also Rhythmuselemente relativ früh mit Kindern erarbeiten. Schon mit Fünfjährigen in der musikalischen Früherziehung arbeite ich mit Noten – mit zwei Achteln, einer Viertelnote, vier Sechzehntelnoten – und verwende Wörter dazu.
Man kann auch eine Rhythmussprache benutzen. Mit diesen Elementen können Kinder ein Rhythmusstück von der Tafel abklatschen.
Sie sagen ja nicht, dass das eine Achtelnote ist, sondern Sie sagen: Das ist ein „Ta-Kat“?
Nein, ich verwende Begriffe wie Wurm, Brot, Brötchen, Honigkuchen – also Alltagsworte. Die Achtel wären zum Beispiel „Brot“, die Sechzehntel vielleicht „Honigkuchen“.
Diese Begriffe bleiben ein paar Wochen bestehen. Das sind Worte, mit denen man den Rhythmus sprechen kann. Alternativ wäre es „Ta“, „Titti“, „Titti-Ta“ – das wäre eine mögliche Rhythmussprache. Es gibt da verschiedene Systeme.
Kraft, Haltung und Wahrnehmung: Körperliches Lernen im Unterricht
Sie hatten auch vorher angesprochen, dass das Thema Kraft eine wichtige Rolle spielt – vor allem bei Kindern, die noch keine Kraftausdauer haben, die man zum Halten eines Instruments braucht. Auch die Haltung, gerade bei der Geige: Diese Handhaltung ist ja ungewohnt für ungeübte Menschen. Ich habe gelesen, dass man mit Kraftübungen, etwa mit Bällen zum Zusammendrücken, spielerisch vermitteln kann, welche Kraftanstrengung notwendig ist. Halten Sie das für sinnvoll?
Ich denke, dass Krafttraining in dem Sinne – also muskuläre Effekte – nur dann entsteht, wenn man regelmäßig und diszipliniert trainiert. Wer ins Fitnessstudio geht, braucht auch noch Ernährung, Eiweiß usw.
Das ist aber nicht nötig im Instrumentalunterricht. Ich würde sagen: „on the job“. Also einfach das machen, was im Instrumentalspiel nötig ist.
Allmählich wächst die Ausdauer. Wichtig ist nur, die Kinder nicht zu überfordern.
Wenn sie überfordert sind, wird alles fest, verkrampft – das wollen wir vermeiden. Die Kraft entwickelt sich mit der Zeit.
Ich mache zwar Übungen mit Bällen oder auch mal Klopfen auf dem Tisch, aber nicht zur systematischen Kraftentwicklung.
Es geht eher darum, Bewusstheit für Bewegungen oder einzelne Finger herzustellen.
Zum Beispiel: Ich habe vier verschiedene Finger, und jeder kann auf den Ball klopfen – das hilft, die Feinmotorik zu schulen.
Da geht es mehr um Wahrnehmung als um Kraftaufbau?
Ja, genau. Wahrnehmung – das ist ein gutes Wort. Das ist für mich überhaupt ein zentrales Thema im Instrumentalunterricht.
Wahrnehmung kultivieren: Die kontemplative Dimension im Musiklernen
In den letzten Jahren beschäftige ich mich viel mit der Didaktik künstlerischen Musizierens. Dazu habe ich auch ein Buch geschrieben. Ich habe darüber gesprochen, Workshops gegeben und mit Kolleginnen und Kollegen daran gearbeitet.
Ich habe dabei vier Dimensionen des Instrumentalunterrichts definiert – eine davon ist die Wahrnehmungsdimension oder auch die kontemplative Dimension.
Das bedeutet: Es sollte im Unterricht Momente geben, in denen es ganz ruhig wird – auch mit Kindern, die sehr unruhig sind.
Ich hoffe, dass es in jeder Stunde wenigstens einen Moment gibt, in dem wir uns ganz auf eine Wahrnehmung konzentrieren – auf den Körper oder einen Klang.
Auch wenn das nur ein kurzer Moment ist, ist er sehr wichtig. Ohne Wahrnehmung können wir unser Instrumentalspiel nicht verfeinern.
Das heißt, dieser Moment ist von Ihnen angeleitet? Sie weisen bewusst darauf hin?
Ja, der Moment ist inszeniert. Ich leite ihn an. Wir setzen uns, manchmal legen wir uns auch hin – je nach Situation.
Dann sage ich zum Beispiel: „Jetzt schließ mal die Augen und hör, was du wahrnimmst.“ Oder: „Wie fühlt sich dein Finger an – ist er gebeugt oder gestreckt?“
Das ist auch, glaube ich, eines der Dinge, die wir hier im Gespräch sehr oft feststellen – dass es ganz viel um das sogenannte metakognitive Lernen geht, also um Selbstwahrnehmung. Wie kann ich mich selbst reflektieren? Was mir bewusst ist, kann ich auch steuern. Was unbewusst passiert, passiert einfach nur so nebenbei, da habe ich gar keinen Einfluss drauf. Nur wenn ich Dinge bewusst wahrnehme, kann ich sie in Zukunft gezielt verändern.
Genau, es geht mir um die bewusste Wahrnehmung. Das ist genau der Punkt.
Erstmal sensorisch – also wirklich um die sensorische Wahrnehmung. Natürlich auch um die Wahrnehmungsverarbeitung. Die Nuancen langsam unterscheiden zu lernen, die Wahrnehmung zu sensibilisieren, feiner zu werden.
Noch nicht so sehr Selbstreflexion – aber den Körper schon, ja.
Wie gehe ich mit hibbeligen Kindern im Unterricht um?
Spannend. Jetzt sind wir in einer fast schon malerisch perfekten Unterrichtsstunde, die Sie hier skizziert haben. Jeder Pädagoge kennt aber auch den Fall des hibbeligen Kindes, das einfach nicht zur Ruhe kommt. Und als Lehrkraft sagt man dann vielleicht pädagogisch nicht sehr sinnvoll: „Jetzt konzentrier dich doch mal!“ Aber das Kind ist wahrscheinlich überfordert und fragt sich: Worauf denn jetzt eigentlich? Es gibt ja von Gerhard Mantel das schöne Bild der rotierenden Aufmerksamkeit – ein Kreislauf, in dem man als Erwachsener gezielt zwischen verschiedenen Wahrnehmungsbereichen wechseln kann. Ich habe mich gefragt: Wie sinnvoll ist es, mit Kindern genauso zu arbeiten? Wie stark kann man sie in eine bestimmte Richtung lenken? Und wie gut lässt sich das umsetzen?
Ich glaube, wenn man sich mit Kindern auf eine Sache konzentrieren möchte, tut man gut daran, zuerst alles andere wegzulassen.
Wenn man sich wirklich auf etwas konzentrieren will – auf das, was im Moment wahrgenommen werden soll –, dann muss man sich klarmachen, wie komplex die Situation ist:
Man steht vor dem Notenständer, hält die Geige und den Bogen, sieht Noten (visueller Reiz), muss diese interpretieren, überlegen, welcher Griff dazugehört…
Wenn es also zum Beispiel um die Knie geht – um Lockerheit in den Beinen – dann sage ich: Noten weg, Geige weg. Dann üben wir nur das. Wir strecken die Beine durch, dann wieder locker lassen. Mit Gegensätzen arbeiten.
Wenn es um das Notenlesen geht: Den Rest weglassen. Hinsetzen. Keine Geige, keine Bogenhaltung – nur Noten lesen.
Wenn es ums Greifen geht: Bogen weg, nur linke Hand. Also immer möglichst viel isolieren.
Und auf meine Frage zurückkommend: Inwieweit kann man das wirklich steuern oder lenken?
Letztlich kann man es nicht steuern.
Das Kind muss es selbst umsetzen. Ich kann als Lehrkraft nichts erzwingen. Es ist immer eine Zusammenarbeit mit dem Kind. Ich muss es für diese Zusammenarbeit gewinnen.
Ich lade das Kind ein: „Lass uns das zusammen machen.“ Aber wenn es nicht will, kann ich es nicht zwingen.
Das gilt besonders für junge Kinder, aber auch für ältere. Die können zwar aus Höflichkeit mitmachen – aber ob innerlich wirklich etwas passiert, weiß ich nicht. Das ist eine Grunderkenntnis.
„Es ist wichtig, von Anfang an – wie ich schon sagte – darüber zu sprechen, was in der kommenden Woche zu Hause passieren soll.“
Michael Dartsch
Motivation und Üben zu Hause: Wie gelingt das?
Das hat natürlich auch Einfluss darauf, inwiefern Schülerinnen und Schüler – egal welchen Alters – zu Hause freiwillig und gerne üben. Was wäre Ihr Tipp an die Lehrkraft? Wie geht man damit um, wenn ein Kind zu Hause nicht übt? Es liegt ja nicht immer daran, dass man das Kind nicht gewinnen konnte, oder?
Das kann verschiedene Gründe haben. Wenn mir jemand sagt: „Ich habe ein Kind, das übt nicht“, dann denke ich vielleicht, der Karren steckt schon halb im Schlamm. Es ist wichtig, von Anfang an – wie ich schon sagte – darüber zu sprechen, was in der kommenden Woche zu Hause passieren soll.
Und dann in der nächsten Stunde nachfragen: Hat das geklappt?
Das kann am Anfang ganz basal sein: „Die Geige soll jeden Tag mal an die frische Luft.“ Sie muss nicht den ganzen Tag im Kasten bleiben.
Das Kind holt sie einfach raus – so wie wir das gelernt haben. Mehr passiert anfangs gar nicht. Allmählich wird es mehr. Im Idealfall sind wir im ständigen Gespräch – mit dem Kind und mit den Eltern – darüber, was klappt und was nicht.
Wir versuchen, eine Routine aufzubauen. Zum Beispiel immer zur gleichen Tageszeit: nach dem Mittagessen, vor den Hausaufgaben – am besten, bevor das Kind müde ist. Und wenn das alles nicht klappt, dann reden.
Mit dem Kind und mit den Eltern: „Du hast es nicht geschafft, jeden Tag zu spielen. Woran lag das?“ Vielleicht sagt das Kind: „Ich hatte keine Lust.“ Dann kann man fragen: „Warum?“
Was ist Ihrer Erfahrung nach der häufigste Grund für diese Lustlosigkeit?
Ich glaube, es liegt oft daran, dass das Kind zu Hause das üben soll, was es noch nicht kann. Und das macht natürlich keinen Spaß. Es ist mühsam. Deshalb lasse ich die Kinder viele Stücke als Hausaufgabe üben – aber die meisten davon sind Stücke, die sie schon können. Vielleicht ein oder zwei neue, der Rest sind bekannte.
Ein sechsjähriges Kind bekommt bei mir sechs Stücke auf – viele Lehrer geben nur ein oder zwei. Aber fünf davon kennt das Kind schon gut.
Und ich rede mit dem Kind darüber: „Welche Stücke wollen wir nächste Woche wieder spielen?“
Das ist in der Regel reine Freude. Denn es kann sie ja schon. Und obwohl es sie schon kann, verbessert sich etwas:
Es wird runder, freier, musikalischer. Die Technik wird feiner. Ich frage am Anfang der Stunde auch gerne: „Mit was möchtest du anfangen?“ Und meist kommen die alten Stücke. Nicht das Neue.
Irgendwann kommt dann das Neue dran: „Wie sieht es damit aus? Brauchst du noch Hilfe?“
Wenn das Kind sagt: „Das habe ich gar nicht hingekriegt“, ist das auch nicht schlimm. Dann helfe ich noch einmal: „Jetzt kannst du es schon besser. Versuch es doch nochmal nächste Woche.“ Vielleicht hilft das, dass das Kind lieber zu Hause spielt.
„Deshalb lasse ich die Kinder viele Stücke als Hausaufgabe üben – aber die meisten davon sind Stücke, die sie schon können. Vielleicht ein oder zwei neue, der Rest sind bekannte.“
Michael Dartsch
Das ist ein schönes Bild. Und auch bei Laien ist es ja nicht anders: Wenn jemand als Erwachsener sagt, ich spiele ein bisschen Klavier oder Trompete – dann spielt man auch lieber, was man schon kann.
Genau. Das macht viel mehr Spaß, als sich an etwas zu quälen, was man noch gar nicht richtig kann.
Sie kennen ja bestimmt auch Nikolaj Petrat, der hat dieses schöne Buch geschrieben: Motivieren zur Musik. Und dann gibt es auch dieses SMART-Ziel-Modell und all sowas. Was mir oft begegnet, ist die Frage: Wenn man – wie Sie gerade als Beispiel genannt haben – viele Stücke gibt, von denen viele das Kind schon spielen kann, dann ist ein anderer Weg ja oft, das Kind mit einzubeziehen: Was möchtest du denn spielen? Das läuft ja, wenn man es überspitzt formuliert, auf eine komplette Individualisierung des Instrumentalunterrichts hinaus, bei der das Kind quasi vollständig bestimmt, was gemacht wird. Halten Sie das für einen gangbaren, sinnvollen Weg?
Das halte ich nicht für gangbar. Und zwar deshalb, weil die Situation im Instrumentalunterricht eine bestimmte ist:
Das Kind bekommt eine Lehrkraft, die Expertin oder Experte auf dem Feld ist – eine Musikerin oder ein Musiker, der das Kind ins Musikersein hineinbegleitet.
Es gibt ein schönes Bild, das Wolfgang Lessing, ein Kollege aus Freiburg, einmal geprägt hat. Er sagte: Der Gestus des Instrumentalunterrichts ist das Hineinnehmen, das Aufnehmen in die Community der Musikerinnen und Musiker.
Diese Community existiert bereits. Das Kind kann nicht sagen: Ich will die aber anders. Sie ist, wie sie ist. Und ich als Lehrkraft kenne diese Community, weiß, wie sie funktioniert, und kann das Kind darin einführen.
Wenn ich das grundsätzliche Einverständnis des Kindes habe – und das ist bereits gegeben, wenn es sagt: „Ich möchte Lieder auf der Geige spielen können“ – dann bin ich die Person, die helfen kann. Das Kind selbst könnte das nicht allein.
Jetzt habe ich sehr dafür gesprochen, dass die Lehrkraft das „Heft in der Hand“ hält – aber das meine ich nicht autoritär. Es ist eine Zusammenarbeit.
Wir beide arbeiten gemeinsam. Das Kind bringt Wünsche und Ideen ein, zeigt, was ihm gefällt, was es leisten kann. Ich bin die Person, die das gemeinsame Ziel im Auge behält: Das Kind möchte musizieren lernen – und ich zeige ihm, wie das geht.
Wichtig ist dabei auch, gemeinsam zu musizieren. Ich übe nicht nur mit dem Kind, ich spiele auch mit ihm. Ich unterstütze es, spiele eine zweite Stimme, helfe, wo es hakt.
Dem Kind vollständig das Heft zu überlassen, halte ich nicht für richtig. Ich sehe den Unterricht als ein Oszillieren zwischen drei Polen:
- Anregen, also einladen, inspirieren.
- Zulassen, auch mal Dinge akzeptieren, die mir vielleicht nicht gefallen.
- Lenken, wo es nötig ist – natürlich nur mit dem Einverständnis des Kindes.
„Es gibt ein schönes Bild, das Wolfgang Lessing, ein Kollege aus Freiburg, einmal geprägt hat. Er sagte: Der Gestus des Instrumentalunterrichts ist das Hineinnehmen, das Aufnehmen in die Community der Musikerinnen und Musiker.“
Michael Dartsch
Community-Gedanke auch für Nicht-Profis: Musizieren als gemeinschaftliches Ziel
Würden Sie sagen, das trifft auch auf Kinder zu, die einfach mal ausprobieren wollen, ob ein Instrument was für sie ist – also ohne das Ziel, Berufsmusiker zu werden? Jeder von uns hat doch als Kind Hobbys gehabt, die später keine große Rolle mehr gespielt haben.
Aber ja. Man weiß am Anfang nicht, wohin das führt.
Für viele ist gerade die Motivation, in einem Musikverein oder Schulorchester mitzuspielen, ein großer Antrieb. Das ist ein ungeheurer Motivator, den wir an Musikschulen noch nicht genug nutzen.
Wenn Anfängergruppen schon früh mit Orchestern oder Spielkreisen in Kontakt kommen, denken sie oft: „Wow, da will ich auch mal mitspielen!“
Und das kann man auch, ohne Berufsmusiker zu werden. Selbst wenn man später aufhört – es ist eine wichtige und schöne Erfahrung. Das ist auch eine Community – nicht nur die der Berufsmusiker, sondern aller, die gemeinsam Musik machen. Diese Erfahrung – mit anderen Musik zu machen – sollte immer Motivation sein.
Ein Kind, das nur rein technisch ein Instrument lernt, ohne zu musizieren, das gibt es meiner Meinung nach nicht.
Zwischen Struktur und Freiheit: Üben mit Raum für Entdeckung
Dem würde ich zustimmen. Üben steht ja oft im Spannungsfeld zwischen einer konkreten Aufgabe und Freiräumen zum Experimentieren. Man möchte Aufgaben geben („Schau dir die fünf Stücke an“), aber auch das Explorieren ermöglichen. Wie schafft man dieses Gleichgewicht – besonders zu Hause, wo das Kind auch selbstständig agieren soll?
Das hängt vom Kind ab. Aber ich sage grundsätzlich: Das Ausprobieren – das Explorative – ist die zweite zentrale Dimension meines Unterrichts.
Nach der kontemplativen Dimension (also der achtsamen Wahrnehmung), ist das Explorative für mich der Königsweg zum Lernen.
Denn selbst wenn eine Lehrkraft sagt: „Mach es so“, kann ein Kind das nicht einfach umsetzen. Es muss ausprobieren:
Wie geht das bei mir? Wie fühlt sich das an? Was funktioniert besser?
Nur durch dieses eigene Probieren erweitert ein Kind sein Verhalten am Instrument. Deshalb muss auch der Unterricht explorativ angelegt sein.
Ich sage zum Beispiel: „Probier mal das aus – was fühlst du?“ oder „Fühlt sich das besser an?“
Wenn man das im Unterricht macht, wird das Kind es zu Hause aufgreifen.
Darüber hinaus kann ich gezielte Aufgaben geben, um das Explorative zu fördern.
Beispiel:
Ich sage dem Kind, es soll die leere D-Saite spielen und auf der A-Saite Töne ausprobieren.
Was klingt gut? Das H – eine Sext. Das D – eine Oktave. Das E, das C – vielleicht eine Septime.
Dann sage ich: „Erfinde kleine Melodien und zeig mir nächste Woche, was dir eingefallen ist.“
Das ist eine konkrete Aufgabe mit offenem Ausgang. Und sie fördert genau das, was später zur musikalischen Freiheit führt.
Jetzt haben Sie ja gerade gesagt, dass Sie die Didaktik des künstlerischen Musizierens verfasst haben. Würden Sie sagen, im Vergleich: Hätten Sie andere Übetipps für Kinder als für Erwachsene?
Eigentlich vom Prinzip her nicht. Die Grundprinzipien – zum Beispiel die kontemplative und die explorative Dimension – bleiben dieselben.
Ich kann die anderen zwei auch gerne noch nennen. Aber grundsätzlich war die Idee, als ich Die Didaktik künstlerischen Musizierens geschrieben habe, genau das zu zeigen:
Dass die Grundprinzipien, die in der EMP – also der Elementaren Musikpädagogik – für Kinder gelten, auch später im Instrumentalunterricht bestehen bleiben. Mich hat gestört, dass das oft als zwei völlig verschiedene Welten gesehen wird:
Da gibt es die Spielwelt mit sogenannten „Früherziehungstanten“, die nicht als richtige Musiker gelten – und dann irgendwann beginnt das „richtige“ Musizieren. Auch in der EMP musizieren Musikerinnen und Musiker mit Kindern. Sie führen die Kinder bereits in die Welt der Musik ein – nur vielseitiger: ins Singen, Tanzen, Improvisieren und auch ins Instrumentalspiel. Die Prinzipien sind im Grunde dieselben.
Ich selbst übe explorativ und kontemplativ – ein kleines Kind sollte das im Idealfall in seinem Rahmen auch tun. Es verfeinert sich nur im Lauf der Zeit. Aber die Prinzipien bleiben.
„Dass die Grundprinzipien, die in der EMP – also der Elementaren Musikpädagogik – für Kinder gelten, auch später im Instrumentalunterricht bestehen bleiben. Mich hat gestört, dass das oft als zwei völlig verschiedene Welten gesehen wird.“
Michael Dartsch
Die vier Dimensionen des künstlerischen Musizierens
Jetzt bin ich aber neugierig: Was sind denn die anderen beiden Dimensionen?
Die dritte Dimension ist die expressive Dimension.
Während sich Kontemplation und Exploration stark auf das Material beziehen – auf die Saiten, das Instrument, die Töne –, kommt bei der Expression hinzu, dass innere Impulse in das Spiel einfließen. Ich muss lernen, das, was ich innerlich empfinde, in mein Spiel hineinfließen zu lassen.
Stellen Sie sich vor, Sie müssten Steinhauen – eine Kunstform, die Ihnen nicht liegt. Es wäre schwer, eigene Impulse darin auszudrücken. So geht es Kindern am Anfang auch, wenn sie Mühe haben, ihr Instrument überhaupt zu halten.
Aber von Anfang an soll das möglich sein. Wir müssen Kinder dazu ermutigen, beim Üben nach Ausdruck zu suchen: Ein Stück fröhlich spielen, ein anderes traurig – mit Adjektiven arbeiten, Geschichten erfinden, mit Bildern arbeiten. Auch ein Tier über dem Stück – wie vorhin erwähnt – kann helfen, diesen Ausdruckswillen hervorzulocken.
Dann kommt die vierte Dimension: die approximative Dimension – also das Sich-Annähern.
Damit meine ich das bewusste Annähern an eine kulturelle Vorgabe, ein musikalisches Vorbild.
Das kann ein ganzes Stück sein oder auch musikalische Strukturen wie Tonalität, Intervalle, das Dur-Moll-System.
Ich spreche hier gerne vom „Nachvollzug“.
Jugendliche oder Studierende, die Brahms oder Bach erarbeiten, versuchen, diese Musik zu durchdringen, ihr gerecht zu werden.
Aber auch Kinder machen das:
In der EMP, wenn sie ein Lied lernen, lernen sie die Melodie, den Rhythmus, versuchen es zuerst „so ungefähr“ zu singen – und irgendwann singen sie es ganz korrekt, mit allen Wörtern, mit korrekter Intonation. Dasselbe passiert im Instrumentalunterricht: Man nähert sich dem Material, dem Stück, der Tradition. Dazu braucht es jemanden, der einem diese kulturellen Dinge zeigt – die Lehrperson. Und diese Dimension beginnt nicht erst bei Beethoven, sondern schon bei Kinderliedern.
„Wir müssen Kinder dazu ermutigen, beim Üben nach Ausdruck zu suchen: Ein Stück fröhlich spielen, ein anderes traurig – mit Adjektiven arbeiten, Geschichten erfinden, mit Bildern arbeiten. Auch ein Tier über dem Stück – wie vorhin erwähnt – kann helfen, diesen Ausdruckswillen hervorzulocken.“
Michael Dartsch
Das Zusammenspiel der vier Dimensionen
In meinem Kopf hat sich gerade ein Bild geformt: ein großer Kreis, in dem die drei Dimensionen – Expressivität, Exploration, Approximierung – liegen. Und außen herum, alles umgreifend, liegt die Kontemplation. Ich habe beim Zuhören den Eindruck, dass sich am Ende alles darauf zurückführen lässt: Bin ich in der Lage, das überhaupt wahrzunehmen, was ich gerade tue? Ob es traurig klingt, ob ich damit dem Stück gerecht werde? Die Fähigkeit zur Wahrnehmung scheint die Königsdisziplin zu sein.
Das ist ein interessanter Hinweis.
Ich habe schon viele Vorträge und Workshops zu dieser Grundidee gegeben – aber den Vorschlag, eine Dimension als umgreifend zu verstehen, habe ich so noch nicht gehört. Da müsste ich mal drüber nachdenken.
Spontan würde ich sagen: Man kann mit einigem Recht jede der vier Dimensionen als umgreifend bezeichnen.
Denn:
Ich kann noch so viel wahrnehmen – wenn ich es nicht ausprobiere, fehlt etwas.
Ich kann vieles nachvollziehen – wenn aber nichts von mir selbst darin steckt, fehlt ebenfalls etwas.
Oder: Ich kann viel ausprobieren – aber ohne Wahrnehmung und Zielrichtung bleibt es beliebig. In bestimmten Unterrichtssituationen ist sicher jede der vier Dimensionen mal dominanter:
Mal liegt der Fokus mehr auf der Kontemplation, mal mehr auf der Expressivität, mal mehr auf dem explorativen Moment. Aber für einen guten künstlerischen Unterricht müssen alle vier Dimensionen präsent sein – und auch beim Üben können sie bewusst einzeln in den Fokus gerückt werden: kontemplativ, explorativ, expressiv oder approximativ – je nachdem, was das Ziel der Übesituation ist.
Das heißt auch: Selbst Improvisation ist nicht frei von approximativen Momenten. Auch da gibt es Traditionen, Systeme, Harmonien, denen man sich annähern muss.
„Aber für einen guten künstlerischen Unterricht müssen alle vier Dimensionen präsent sein – und auch beim Üben können sie bewusst einzeln in den Fokus gerückt werden: kontemplativ, explorativ, expressiv oder approximativ – je nachdem, was das Ziel der Übesituation ist.“
Michael Dartsch
Eltern als Übepartner: Begleiter oder Störfaktor?
Das ist eigentlich eine schöne Klammer, die sich da schließt – oder eine neue kleine Klammer, die sich aufmacht. Denn wenn wir jetzt nochmal an Kinder denken und an den Unterricht mit Kindern, dann ist es vor allem am Anfang so, dass Kinder mit ihren Eltern üben. Zumindest stellt sich oft die Frage: Soll ich mit meinem Kind üben oder nicht? Wäre das in Ihrem Sinne förderlich, dass das Kind zu Hause angeleitet wird?
Das kommt auf den Einzelfall an.
Ich denke, es ist auf jeden Fall wichtig, dass die Eltern mit dem Kind eine Übe-Routine einüben. Ebenso wichtig ist es, dass sie Anteil am Spiel des Kindes nehmen: sich freuen, wenn etwas gut klappt, loben – „Wow, das hat toll geklungen!“ – und eventuell an Dinge erinnern, die sie aus dem Unterricht mitbekommen haben. Dafür müssten sie natürlich im Unterricht dabei gewesen sein.
Es gibt aber auch Konstellationen, in denen Kinder sich von ihren Eltern nicht viel sagen lassen möchten. Dann kommt eher: „Aber mein Lehrer hat gesagt …“ oder „Meine Lehrerin hat das so erklärt.“
Wenn das emotionale Verhältnis zwischen Eltern und Kind zu eng ist, kann Kritik schnell zu Streit führen. Dann funktioniert das gemeinsame Üben nicht.
Was Kritik betrifft, sollten Eltern sehr sensibel sein. Es muss nicht bedeuten, dass man daneben sitzt. Es reicht auch, wenn das Kind im Zimmer übt, die Tür offen ist, und der Vater in der Küche zum Beispiel sagt: „Wow, das hat jetzt toll geklungen!“ oder auf eine Frage reagiert: „War das jetzt gut?“
Das hängt stark von der Konstellation ab – und auch vom Alter des Kindes. Bei jüngeren Kindern ist die Begleitung durch die Eltern sehr wichtig.
Bei acht- oder neunjährigen Kindern beginne ich aber auch zu sagen: Lassen Sie Ihr Kind mal alleine üben. Anfangs vielleicht nur am Anfang oder am Ende der Übezeit dabeibleiben, aber zwischendurch das Kind auch allein lassen.
So kann sich Selbstständigkeit aufbauen. Und das hat natürlich auch mit unserem kulturellen Kontext zu tun, in dem Autonomie und Individualität hochgeschätzte Werte sind.
In anderen Kontexten wäre es vielleicht ganz normal, dass Eltern lange dabei bleiben. Man muss also spüren, was für die jeweilige Familie richtig ist – auch abhängig davon, wie die Eltern sich dabei fühlen.
Es gibt Eltern, die haben einfach nicht die Möglichkeit, dabeizusein – sie sind nicht zu Hause, wenn das Kind übt.
Was Eltern tun – und was sie besser lassen sollten
Das heißt: Ein „Do“ wäre, das Kind positiv zu bestärken und seine Selbstständigkeit zu fördern. Und ein „Don’t“ wäre, das Kind zu kritisieren – so hatten Sie es vorher genannt?
Ja, das kann man so zusammenfassen.
Helfen – ja. Aber nicht auf eine Weise, die das Kind als persönliche Kritik empfindet. Damit sollte man sehr vorsichtig sein. Ein „Do“ wäre auch, das Kind ans Üben zu erinnern: „Komm, lass uns jetzt noch üben“ ist besser als: „Du musst jetzt noch üben.“ Das klingt einladender und führt oft zu mehr Bereitschaft.
Das heißt, der Elternteil muss auf jeden Fall dabei sein?
Dabei sein – ja. Aber das kann, wie gesagt, auch aus dem Nebenraum heraus passieren.
Wichtig ist: Der Elternteil muss sich bewusst Zeit nehmen und in irgendeiner Form erreichbar sein – vor allem am Anfang. Denn das Instrumentalspiel ist eine komplexe kulturelle Fähigkeit.
Zwar lernt ein Kind vieles „privilegiert“ – Gehen, Sprechen –, aber auch da braucht es Menschen, die mit ihm gehen, mit ihm sprechen. Instrumentalspiel hingegen ist eine hochentwickelte Kulturtechnik. Sie braucht Anleitung, Unterricht und regelmäßiges Üben. So wie andere schulische Inhalte auch.
„Komm, lass uns jetzt noch üben“ ist besser als: „Du musst jetzt noch üben.“ Das klingt einladender und führt oft zu mehr Bereitschaft.“
Michael Dartsch
Blick in die Zukunft: Wo entwickelt sich Instrumentalunterricht hin?
Ganz zu Anfang hatten wir den Blick in die Vergangenheit gerichtet – etwa bei den Tierfiguren in Instrumentalschulen. Wenn wir nun einen Ausblick wagen: Was wären Ihrer Meinung nach Trends und Entwicklungen, in die sich der Instrumentalunterricht künftig bewegen könnte? Ich habe zum Beispiel gelesen, dass Musikschulen stärker als Lernorte verstanden werden könnten – auch in Bezug auf das Üben zu Hause. Gibt es Entwicklungen, die Sie beobachten?
Ja, solche Trends zeichnen sich ab – allerdings entwickeln sich Theorie und Praxis oft unterschiedlich schnell. Die Idee des „Lernorts Musikschule“, wie sie etwa Andreas Dörney propagiert – ein Ort, an dem Kinder Aufnahmen machen, Musik hören, sich austauschen, einfach „rumhängen“ können – wurde in der Szene sehr positiv aufgenommen.
Aber in der Praxis gibt es bisher kaum Musikschulen, die das konkret umsetzen konnten. Das liegt an den Rahmenbedingungen. Man braucht viel Raum, viele Ressourcen. In vielen Musikschulen sind nachmittags alle Räume durch Unterricht belegt.
Da ist kein Platz mehr, an dem Kinder zusätzlich frei üben könnten. In asiatischen Ländern, erzählen meine Studierenden, sei das anders:
Dort gehen Kinder nachmittags in die Musikschule, um dort zu üben – teilweise mit Betreuung durch Lehrkräfte, die beim Üben helfen.
Dieses Modell ist bei uns noch nicht weit verbreitet. Es gibt allerdings Einzelfälle: Ein Kollege von mir hat am Standort Essen-Krei ein „Übehaus“ entwickelt.
Eine meiner Studentinnen hat im Rahmen ihrer Masterarbeit gemeinsam mit Kolleginnen ebenfalls an der Mosel ein solches Konzept umgesetzt – inklusive bezahlter Betreuungszeit der Lehrkräfte. Aber es bringt kein zusätzliches Einkommen für die Musikschule – das ist ein finanzieller Engpass.
Deshalb sehe ich dieses Modell nicht als den ersten großen Trend.
Digitale Perspektiven: Tutorials, Videos und flexibles Lernen
Was wäre dann Ihrer Meinung nach der wahrscheinliche Trend?
Ich glaube, dass das Internet und digitale Medien in Zukunft eine deutlich größere Rolle spielen werden.
Schon heute nutzen viele Lehrkräfte technische Mittel:
- Sie lassen sich Aufnahmen von Kindern schicken und geben Feedback.
- Sie nehmen selbst etwas auf und senden es den Kindern.
- Sie erstellen Tutorials, die Kinder zu Hause nutzen können.
Zum Beispiel:
Ein Video, in dem genau gezeigt wird, wie man die Geige hält, den Bogen richtig fasst, den Arm dreht usw.
Diese Tutorials können dann immer wieder angeschaut werden – ein wertvolles Hilfsmittel.
Ich glaube, junge Lehrkräfte nutzen das bereits viel mehr als meine Generation.
Und es ist gut möglich, dass künftig viele Jugendliche mit solchen Tutorials anfangen – zwei Jahre lang autodidaktisch lernen – und dann zur Lehrkraft kommen, wenn sie ein Problem nicht mehr selbst lösen können.
In diesem Szenario wird die Lehrkraft mehr zur Dienstleisterin: Sie hilft gezielt bei konkreten Fragestellungen, das Lernen selbst ist aber stark digital geprägt. Ich halte das nicht für ausgeschlossen – auch wenn es Risiken birgt. Aber das wäre aus meiner Sicht ein sehr realistischer Trend.
Zwischen Vision und Realität: Musikschule als Lernort
Sie gucken erstaunt?
Nein, also ähnlich auf jeden Fall. Ich finde diese Utopie von der Musikschule als Lernort sehr wünschenswert – das ist auf jeden Fall eine schöne Vorstellung.
Ich sehe nur in der Praxis kaum Entwicklungen, gerade was die Rahmenbedingungen betrifft. Die Raumnot, der Platzmangel…Das Herrenberg-Urteil ist Ihnen ein Begriff? Musikschulen müssen ihre Honorarstellen eigentlich umstellen. Die Kommunen sind finanziell stark belastet.
Jetzt auch noch Lernorte mit mehr Platz? Dafür bräuchte es im Grunde Neubauten. Andreas Dörner wünscht sich gläserne Türen, damit man hineinsehen kann, damit gemeinsames Üben sichtbar wird.
Der eine sieht den anderen, man winkt sich zu – das sind tolle Ideen. Vielleicht kommen sie irgendwann, das wäre schön. Aber aktuell sehe ich wenig konkrete Hinweise darauf, dass sich das durchsetzt.
Das ist, was ich meine: Der Unterschied zwischen Theorie und Praxis ist deutlich spürbar.
Zwischen Gemeinschaft und Individualisierung: Zwei gegensätzliche Trends?
Was Sie gerade mit den Apps und Tutorials angesprochen haben, ist ja im Grunde ein gegenläufiger Trend: mehr Individualisierung zu Hause – weg vom Gemeinschaftlichen.
Genau.
Wir sehen auch, dass sich Menschen immer weniger gerne langfristig binden. Allein, dass man sich nur zum Schuljahr oder Halbjahr abmelden kann, ist für viele unattraktiv. Vielleicht müsste man über 10-Stunden-Pakete nachdenken – wie bei der Volkshochschule.
Das würden wahrscheinlich viele Erwachsene in Anspruch nehmen. Generell wird der Unterricht mit Erwachsenen zunehmen – insbesondere auch mit älteren Erwachsenen nach der Pensionierung.
In Lehrversuchen begegnen mir mittlerweile fast genauso viele Erwachsene wie Kinder – gerade im Geigenunterricht. Viele dieser Erwachsenen sind sehr autonom:
Sie entscheiden sich bewusst für das Instrument und sagen dann auch mal: „In den nächsten zwei Wochen habe ich keine Zeit. Das ist eine ganz andere Art zu arbeiten als mit Kindern.
Digitale Tools als sinnvolle Ergänzung – mit Grenzen
Das heißt, Sie sind gar nicht kritisch gegenüber Apps und Self-Learning-Plattformen? Sehen Sie sie eher als Ergänzung – also nicht als Konkurrenz zum Präsenzunterricht?
Ich habe das bisher nicht gewertet – ich habe nur gesagt: Ich glaube, das wird kommen.
Und ich denke, wenn sich eine Entwicklung ohnehin nicht aufhalten lässt, dann sollte man schauen, wie man sie sinnvoll einsetzt. Wo ist es fruchtbar? Wo sehe ich Gefahren? Natürlich glaube ich auch: Der Face-to-Face-Kontakt, das Zusammensein mit dem Kind im Raum, Körperübungen, gemeinsames Spielen –
das lässt sich nicht durch Video-Unterricht oder Apps ersetzen. Da würde viel verloren gehen. Aber manche Dinge sind eben nicht aufzuhalten. Und dann sollten wir überlegen, wo digitale Mittel sinnvoll sind.
Ein Beispiel:
Das Kind hat ein Tutorial zu Hause, das es zusätzlich zum Unterricht nutzt.
Es kann eine Aufnahme an die Lehrkraft schicken oder eine bekommen. Das sind alles sinnvolle Ergänzungen.
Kritisch wird es für mich dort, wo die Lehrperson komplett ersetzt wird – oder der persönliche Kontakt wegfällt. Auch das Musizieren in Echtzeit mit jemandem auf Distanz bietet tolle Möglichkeiten.
Aber ich bin mir nicht sicher, ob das dasselbe ist wie gemeinsam in einem Raum zu sein: Schwingungen spüren, vielleicht sogar eine Angleichung von Hirnfrequenzen oder Herzschlägen…
Passiert das auch über Video? Ich weiß es nicht. Das müsste man wissenschaftlich untersuchen.
Grundsätzlich bin ich nicht skeptisch gegenüber solchen Entwicklungen – aber ich beobachte sie differenziert.
Persönlicher Abschluss: Lernen, Neugier und Bildung
Sehr spannend. Wir könnten darüber noch eine Stunde reden. Mit Blick auf die Uhr hätte ich noch zwei Abschlussfragen, die ich allen meinen Gästen stelle.
Was lernen oder üben Sie gerade, was Sie noch nicht so gut können? Das darf auch gerne nicht-musikalisch sein.
Ach so – es darf auch etwas Nicht-Musikalisches sein?
Dann sage ich: Ich lerne Ungarisch. Das kann ich noch nicht so gut. Ich lerne aber nicht täglich, es ist ein Projekt, das sich über mehrere Jahre erstreckt. Aber ich bin dran.
Warum gerade Ungarisch?
Weil meine Frau Ungarin ist. Als wir vor fast 30 Jahren zusammengekommen sind, habe ich angefangen, Ungarisch zu lernen.
Immer wenn Verwandte zu Besuch sind, habe ich wieder einen Anlass, ein bisschen mehr zu lernen. Das ist etwas, das ich gerne besser können möchte – aber es braucht Gelegenheit und regelmäßiges Üben.
Und was wäre ein Tipp, den Sie Ihrem jüngeren Ich als Musik-Erstsemester mitgeben würden – aus heutiger Sicht? Etwas, worüber Sie heute froh wären, es früher gewusst zu haben?
Offen und neugierig alles mitnehmen, was man bekommen kann. Ich bin damals aus einer kleinen Stadt nach Köln gekommen und war ganz viel in Konzerten, in Klassenvorspielen.
An der Hochschule war ich bei allen möglichen Veranstaltungen. Heute sehe ich oft: In Klassenvorspielen sind fast nur die Mitglieder der eigenen Klasse anwesend. Ich würde sagen: Geht auch zu Veranstaltungen, die ihr nicht müsst – wenn sie euch interessieren. Geht ins Theater – das ist für Studierende oft kostenlos. Nutzt diese Zeit! Das Studium ist eine Phase der Bildung, der Horizonterweiterung.
Später hat man diese Freiheit nicht mehr. Alles ist fast kostenlos – Konzerte, Vorträge, Theater. Und das öffnet neue Perspektiven. Das ist für mich echte Bildung: Offen für alles sein, was möglich ist.
Das ist ein schönes Schlusswort. Herr Dartsch, ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit.
Sehr gerne. Hat Spaß gemacht.
Wer schreibt hier eigentlich..?
Patrick Hinsberger studierte Jazz Trompete bei Matthieu Michel und Bert Joris und schloss sein Studium im Sommer 2020 an der Hochschule der Künste in Bern (Schweiz) ab.
Seit seiner Bachelor-Arbeit beschäftigt er sich intensiv mit dem Thema musikalisches Üben und hostet seit 2021 den Interview-Podcast "Wie übt eigentlich..?"