Alle tun es, doch es scheint, als möchte niemand allzu gerne darüber sprechen. Üben. Musiker*innen verschiedenster Genres verbringen im Laufe ihrer Karriere Tausende von Stunden mit ihrem Instrument, ohne dabei wirklich regelmäßig den Austausch zu anderen zu suchen und zu erfragen, was er oder sie denn gerade so übe. Der Prozess musikalischer Weiterentwicklung versteckt sich hinter einer großen Portion Mystik, deren Schleier niemand recht lüften möchte. Sei es aus Scham, Konkurrenzdenken oder schlicht weil man nie so recht auf dieses Thema zu sprechen kommt.
Doch wäre es nicht gerade interessant zu wissen, was der Kommilitone, der Mitspieler*in oder Freund*in in Verein und Band gerade so an seinem Instrument erarbeitet? Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass man eventuell selbst gerade das Gleiche übt und gegenseitig von Tipps und Ratschlägen profitieren könnte? Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein erfahrener Spieler einem selbst neue Inspiration und Impulse für die nächste Übesession geben kann, einem ein neues Stück zeigt oder man durch das Gespräch einen neuen Spieler kennenlernt?
All diese Fragen, die sonst viel zu selten gestellt werden möchte ich in Zukunft regelmäßig in der Reihe „Wie übt eigentlich…?“ versuchen zu beantworten. Denn von anderen lernen heißt auch immer über sich selbst etwas zu erfahren.
Lieber hören statt lesen?
Die Folge mit Christian Pabst lässt sich auf allen bekannten Streaming Plattformen kostenlos anhören.
Diesen Monat: Christian Pabst
„This beauty comes from within, from the depth of the music, and leaves space for always new associations“ schrieb das Jazzpodium mal über die Musik von Christian Pabst. Und nach dem Gespräch mit kann ich dem nur zu 100% zustimmen.
Zweifellos gehört Christian Pabst zu einem der gefragtesten Jazzpianisten in Europa. Aber nicht nur als Instrumentalist hat er sich inzwischen einen Namen erworben. Als Dozent unterrichtet er mittlerweile an der Hochschule für Musik Saar und als Gastdozent am Conservatorium in Amsterdam.
Wenn man Christian Pabst im Gespräch zuhört, kann man schon mal den Eindruck gewinnen, dass sein Tag mehr als 24 Stunden hat. Leben in Italien, unterrichten in Deutschland und den Niederlanden – dazu internationale Reisen für Konzerte. Dazwischen Zeit für die Familie, Üben und während der Pandemie blieb sogar noch etwas Muße zum Lesen übrig.
Wie er es schafft, das alles unter einen Hut zu bekommen und wie er es vor allen Dingen geschafft hat musikalisches Selbstbewusstsein zu entwickeln und seine eigene Sprache zu finden, darüber haben wir im Podcast gesprochen.
Mehr Infos zu Christian Pabst: www.christianpabst.com
Das Interview: Wie übt eigentlich Christian Pabst?
Übersicht
- Wie hast du deine eigene Stimme gefunden?
- Musikalisches Selbstbewusstsein
- Rede Keith Jarrett
- „Szenen vertonen“ – Inspiration für neue Musik
- Was lernst du gerade, was du noch nicht so gut kannst?
Wie hast du deine eigene Stimme gefunden?
Vervollständige folgenden Satz: Übten heißt für dich…
Spaß und Freiheit.
Welche Musik (Album / Künstler) läuft bei dir gerade in Dauerschleife ?
Bei mir läuft gerade Gonzalo Rubalcaba in Dauerschleife. Ein kubanischer Pianist, der mich gerade sehr inspiriert.
Er hat ein tolles Duo-Album („Tokyo Adagio“) mit Charlie Haden aufgenommen. Ich konnte ihn letztes Jahr auch live sehen.
Bei mir ist es so, dass ich immer einen bestimmten Künstler für einen Monat im Fokus habe und ihn besonders viel höre. Also aktuell bin ich in meiner Gonzalo Rubalcaba-Phase.
Welcher Künstler war in deiner Phase davor?
Gustav Mahler (lacht). Vor allem die zweite und dritte Symphonie.
Das heißt, dass diese „Phasen“ gar nicht nur Jazz-spezifisch sind, sondern ganz breit gestreut?
Ja, auf jeden Fall. Ich versuche eigentlich Musik so universell wie möglich aufzufassen. Ich komme natürlich aus dem Jazz, und habe hier viele Projekte, allerdings versuche ich diese Genre-Zuschreibungen zu vermeiden und es einfach als Musik zu bezeichnen. Dadurch hält man sich viel mehr Türen offen für Neues. Und meistens inspiriert mich auch einfach alles.
Wenn du sagst, dass du phasenweise verschiedene Künstler sehr fokussiert hörst, verbindest du das dann auch mit dem Erstellen von Transkriptionen oder ist es eher ein Hören, um Inspirationen zu sammeln?
Es gibt zwei verschiedene Arten von Hören bei mir: Das eine ist nur zur Inspiration, zum Spaß und natürlich zum Genießen. Das andere Hören ist ganz klar für meine Arbeit.
Wenn ich beispielsweise eine CD-Aufnahme vorbereite, und die Musik ist in einem bestimmten Stil, dann versuche ich mir zu Hause eine musikalische Umgebung zu schaffen, die diesen Stil mit Ideen nährt.
Mit den Transkriptionen ist es bei mir so eine Sache. Ich habe früher sehr viel transkribiert. Inzwischen ist es aber so, dass wenn ich etwas höre, das mir sehr gut gefällt, ich es zwar aufschreibe– allerdings sind das meistens nur kleine Phrasen. Also ein bis zwei Takte, oder mal ein Akkord.
„Ich finde, wenn man – wie in meinem Fall ein Jazz-Pianist sein möchte, dann sollte man auch verstehen, was die Leute vor einem gemacht haben. Denn, die Künstler*innen, die ihre eigene Stimme gefunden haben, haben sie dadurch gefunden, dass sie sich wirklich intensiv mit der Musik auseinandergesetzt haben.“
(Christian Pabst)
Könntest du einen der Künstler, die du mal phasenweise sehr stark gehört hast, herausgreifen und sagen, dass der dich (auf dein Spiel bezogen) am meisten geprägt hat?
Mittlerweile nicht mehr. Hoffe ich (lacht).
Früher waren diese Phasen, in denen ich von einer Person inspiriert war, viel länger. Ich hatte mal eine ganz lange Herbie Hancock-Phase oder eine lange Oscar Peterson Phase, die man anschließend auch immer in meinem Spiel gehört hat. Soweit, dass es anderen Leute sogar aufgefallen ist und mich es selbst gestört hat.
Gerade in der Jazz-Erziehung gibt es ja diese Polemik, ob man versuchen sollte andere Künstler*innen zu kopieren oder, ob man das gar nicht versuchen sollte – um seine eigene Stimme zu finden. Ich positioniere mich hier ziemlich in der Mitte.
Ich finde, wenn man – wie in meinem Fall ein Jazz-Pianist sein möchte – dann sollte man auch verstehen, was die Leute vor einem gemacht haben. Denn, die Künstler*innen, die ihre eigene Stimme gefunden haben, haben sie dadurch gefunden, dass sie sich wirklich intensiv mit der Musik auseinandergesetzt haben.
Von daher war das bei mir, während des Studiums, eine natürliche Entwicklung. Ich wollte verstehen, wie das alles funktioniert. Und jetzt glaube ich, dass ich mich davon immer mehr emanzipiert habe und immer mehr verstanden habe, wie ich kreativer und mit mehr Freiheit mit dem Material umgehen kann.
Ich denke, es ist ein wichtiger Prozess, wenn man Improvisation lernen möchte, dass es nicht darum geht, das was man gehört hat genau zu kopieren. Sondern das sollte immer nur eine Startrampe zur eigenen Kreativität sein. Das jedoch für einen selbst wirklich zu verinnerlichen, benötigt Zeit.
Kannst du beschreiben, wie du das geschafft hast?
Gute Frage. Ich glaube, es hat viel mit musikalischer Reife und Erfahrung zu tun.
Wenn man über die Jahre mit vielen verschiedenen Musiker*innen aus unterschiedlichen Stilrichtungen zusammenspielt, oder auch selbst komponiert, hat es sich für mich so angefühlt, als ob dies immer zwingender beginnt mein eigener Stil zu werden.
Eigentlich ist es aber eine Kombination aus musikalischer Erfahrung sammeln sowie mentaler und künstlerischer Reife, die mir das Selbstbewusstsein vermittelt hat, Sachen nicht zu machen, um mich auf andere Dinge zu konzentrieren. Ich würde es daher ein künstlerisches Selbstbewusstsein nennen, welches aus der konstanten Arbeit mit Musik wächst.
Wenn ich es jetzt aber auf eine konkrete Übung in meinem Alltag übertragen müsste, dann wäre dies jede musikalische Idee auf ihren kleinsten gemeinsamen Nenner herunterzubrechen. Um davon ausgehend so viele Varianten wie möglich heraus zu filtern.
Das heißt, wenn ich eine Phrase von einem anderen Musiker höre und möchte verstehen, was er dort macht, dann würde ich diese nie 1:1 so spielen. Klar, am Anfang möchte ich begreifen, was er dort gemacht hat. Aber dann würde ich schauen, was die melodische, die rhythmische oder die harmonische Struktur ist. Ich würde die Phrase rückwärts spielen, sie in einer anderen Taktart spielen, in eine andere Tonart transponieren oder sie über einen anderen Akkord spielen.
Auf diese Weise findet man stetig neue Ideen, die einem gefallen, da einem bereits das Ausgangsmaterial gut gefallen hat. Die aber trotz allem immer eigen klingen werden, weil es nicht die exakte Kopie des Originals ist – also nicht dieses typische Spielen von Licks & Pattern.
„Eigentlich ist es aber eine Kombination aus musikalischer Erfahrung sammeln sowie mentaler und künstlerischer Reife, die mir das Selbstbewusstsein vermittelt hat, Sachen nicht zu machen, um mich auf andere Dinge zu konzentrieren. Ich würde es daher ein künstlerisches Selbstbewusstsein nennen, welches aus der konstanten Arbeit mit Musik wächst.“
(Christian Pabst)
Das heißt, dass du beim Üben auch immer sehr analytisch vorgehst? Dass du dir sehr genau überlegst, welche Möglichkeiten diese Phrase hat und dir daraus einen Übeplan für die nächste Stunde bzw. die nächsten Wochen machst?
Genau, ich versuche mir dann daraus einen eigenen Übeplan zu erstellen. Aber was du gerade ansprichst ist sehr wichtig beim Üben: Auf der einen Seite versuche ich so detailversessen, konkret und diszipliniert wie möglich zu arbeiten. Gleichzeitig versuche ich aber auch immer genügend Platz zum Spielen zu lassen.
Ich hatte mal eine Phase, in der ich meine Technik verbessern wollte. Damals habe ich den ganzen Tag lang Klassik und alle möglichen Skalen geübt. Das hat sich natürlich anschließend auch auf mein Spiel ausgewirkt. Bei den Soli hatte ich immer das Gefühl, dass ich aus diesen Skalen nicht mehr herauskomme. Deshalb finde ich es so wichtig in improvisierter Musik, dass man immer Platz für Phasen lässt, in denen man einfach nur spielt.
Damit ich ein besseres Monitoring hierüber habe, führe ich ein Übetagebuch. Wenn ich dann sehe, ich habe gleich eine Übesession über ein paar Stunden zu Verfügung und habe am Vortag viele Sachen geübt, die eher auf Handwerk aus sind, dann würde ich in der anstehenden Session eher ein paar Standards spielen oder über ein Stück solieren, welches ich demnächst aufnehme. Auf jeden Fall sehr frei und ohne viel Nachdenken. Einfach um diesen Flow zu üben, den man bei Konzerten haben muss. Ich finde es wichtig, dass man Musik machen auch zu Hause übt.
Ich sehe bei ein paar Studierenden, dass es eine Art Trennwand gibt, zwischen Übezimmer und der Hochschule, wo man alles sehr genau übt und dem Loslassen, wenn dann ein Konzert ansteht. Diese Brücke sollte man versuchen immer zu bauen. Daher habe ich eingangs auch gesagt „Üben ist Spaß und Freiheit“, weil es am Ende immer eine Suche nach musikalischer Schönheit und Dinge, die einen berühren ist.
Das kenne ich ebenfalls noch aus meiner eigenen Zeit im Studium. Man sieht sich anfangs mit einem Berg von Input konfrontiert und vergisst oftmals – so ging es mir zumindest- dabei das eigentliche Musik machen etwas. Sobald man dann aber wieder anfängt den eigenen Ideen beim Üben mehr Raum zu geben, und quasi seinem inneren Ohr folgt, werden auch Soli wieder spannender.
Ja, total. Ich glaube in der Sache sind zwei Dinge wichtig: Zum einen glaube ich ist es, während eines Musik-Studiums, ein ganz natürlicher Prozess, dass man sich die Frage stellt, wie man diese ganzen Informationen verarbeiten soll. In dieser Phase bleiben viele Studierende stecken. Hier geht dann oftmals auch ein wenig der Spaß an der Musik verloren. Andererseits muss man als professioneller Musiker auch einfach abliefern können. Man sollte versuchen zu akzeptieren, dass dies Hand in Hand geht.
Bei mir ist es beispielsweise so, wenn ich auf die Bühne gehe und merke es fließt, weil ich genug Zeit ins Üben investiert habe, habe ich auch viel mehr Spaß.
Ab und zu muss man dann vielleicht durch solche Phasen durch, in denen es hart ist und man diesen Spaß gerade nicht sieht. Dann sollte man sich aber ins Gedächtnis rufen, dass wenn man auf der Bühne steht, und man loslassen kann, dieser Spaß wieder da ist.
Die zweite Sache habe ich leider vergessen.
Musikalisches Selbstbewusstsein
Kommt sicher noch… Um vielleicht gerade den Bogen zu spannen, bevor ich hierauf konkret eingehen möchte. Wenn man dein Tourplan online verfolgt, sieht man, dass du wieder etwas mehr unterwegs warst seit Anfang des Jahres. Zusätzlich unterrichtest du ja noch als Gastdozent am Conservatorium in Amsterdam und als Dozent an der Hochschule in Saarbrücken. Lebst allerdings gerade in Italien. Das bedeutet natürlich auch viel Reisen. Kannst du schildern, wie du dein Üben aktuell planst und über den Tag einteilst?
Ich muss gestehen, dass ich aktuell sehr wenig Zeit zum Üben habe, auch weil ich gerade Vater von Zwillingen geworden bin. Mein Schlafpensum ist entsprechend sehr gering und mein Übepensum ebenso. Das ist für mich als Musiker natürlich eine schwierige Situation: Weil, wenn ich nicht üben kann, bin ich schlechter gelaunt. Ich brauche diese Beschäftigung mit Musik auf der einen Seite, um das Gefühl zu haben, dass ich mein Handwerk unter Kontrolle habe. Und auf der anderen Seite, um das Gefühl zu haben, dass es weiter geht.
Wenn dazu noch internationale Reise kommen, versuche ich so zielsicher wie ich kann zu üben. Wenn ich weiß, ich habe heute nur eine oder zwei Stunden Zeit, dann habe ich nicht diesen Luxus einfach drauf los zu spielen. Das ist einerseits schade, aber auch gut, weil es mich dazu zwingt sehr effektiv zu sein.
Hierzu habe ich dann auch mein „gefürchtetes“ Übetagebuch. Meistens ist so, dass ich dieses in verschiedene Felder versuche zu strukturieren: Technik, Harmonie, Komposition, Repertoire, Rhythmus. Diese groben Felder versuche ich dann mit konkreten Übungen zu füllen.
Dadurch, dass ich gerade weniger Zeit zum Üben habe, versuche ich all diese Felder immer auch an Stücken zu üben, die ich demnächst live spielen werde. Klar, bei Technik ist es noch so, dass ich trotzdem auch klassische Etuden übe, die ich nicht live spiele. Das ist aber dann meistens eher zum Aufwärmen.
Das, was man auch live spielt, sollte beim Üben immer an erster Stelle stehen.
Würdest du sagen, dass diese Effizienz nur dem „Zeitmangel“ geschuldet ist. Oder ist das etwas, dass sich über die letzten Jahre, beispielsweise auch durch das Unterrichten, entwickelt hat?
Auf jeden Fall kommt das auch daher. Ich unterrichte sehr genau, auch weil ich dadurch das Gefühl habe, dass ich selbst noch als Musiker wachse. Wenn ich Studierenden Dinge erkläre, erkläre ich sie mir gleichzeitig auch selbst.
Ich muss aber ehrlich sagen, wenn ich die Zeit hätte, würde ich immer noch alles anhand aller Standards üben. Oder weitere Themenfelder für mich entdecken. Aber der Tag hat halt leider nur 24 Stunden.
Aber das ist ja das Schöne an der Musik, die wir machen (zumindest fühle ich das so): Das Material und die Inspiration wird uns nie ausgehen.
„Vor allem diese mentale Seite am Musik machen wird zu sehr unterschätzt. Ich glaube, dass man eigentlich viel mehr kann, als man sich selbst zugesteht, weil man sich konstant blockiert. Und weil wir in einer Welt leben, die es einem nicht leichter macht, sich als Mensch zu öffnen.“
(Christian Pabst)
Du erwähnst es gerade bereits: Der Tag hat nur 24 Stunden. Das heißt, wenn dann mal zwei Stunden Übezeit abfallen, sollte man im besten Fall auch gleich bereit sein durchzustarten. Wie kommst du dabei in den Fokus? Einfach direkt starten oder hast du eine Art Ritual, um in eine Art „Flow“ zu kommen?
Das ist auf jeden Fall ein Aspekt, mit dem ich früher viel zu tun hatte. Aber inzwischen hilft mir hier vor allem meine Konzerterfahrung.
Vor allem vor Corona habe ich extrem viel gespielt. Da gab es manchmal Projekte, mit denen wir 40 Konzerte innerhalb weniger Wochen gespielt haben. Anfangs ist man bei den ersten Konzerten vielleicht noch etwas nervös. Irgendwann kommt man jedoch in einen Flow hinein, bei dem Musik machen nichts anderes mehr ist als Zähne putzen. Die mentale Trennwand, dass man denkt, man müsse nun performen und den Leuten etwas präsentieren, die gibt es dann nicht mehr.
Ich habe mal eine tolle Rede von Keith Jarrett gelesen, der für sein Lebenswerk ausgezeichnet wurde. Normalerweise geht er auf solche Events nicht hin, aber scheinbar hat er bei diesem Mal eine Ausnahme gemacht. Seine Rede ist mir sehr im Kopf hängen geblieben. Er meinte: Vielen Dank für den Preis, aber eigentlich interessieren mich Preise nicht. Was mich interessiert ist Musik. Preise inspirieren mich nicht, Musik inspiriert mich.
Er hat dann über Musik geredet und meinte, Musik sei immer da. Musik ist wie ein Fluss, der immer fließt und in den man nur hineinspringen und sich treiben lassen muss. Das hört man natürlich in seinem Spiel.
Dass man sich der Idee öffnet, dass Musik etwas Allgegenwärtiges ist. Eine Welt, die man einfach nur betreten muss. Aber, dass man diesen Schritt eben ganz bewusst machen muss.
Rede Keith Jarrett „Music is in the air and you find it, or it’s in the air and you don’t find it.“
Ich finde was, hier auffällt, auch in der Art und Weise wie du über Musik sprichst, dass das viel mit Selbstreflexion zu tun hat. Dass man immer als Musik*in, und vielleicht als improvisierender mehr als klassische Musiker*innen, in sich hinein horchen muss und sollte, um zu wissen wo man steht, welche Künstlerpersönlichkeit bin und wo ist die Musik, zu der ich mich hingezogen fühle.
Total. Vor allem diese mentale Seite am Musik machen wird zu sehr unterschätzt. Ich glaube, dass man eigentlich viel mehr kann, als man sich selbst zugesteht, weil man sich konstant blockiert. Und weil wir in einer Welt leben, die es einem nicht leichter macht, sich als Mensch zu öffnen.
Ich versuche mal ein Beispiel zu machen: Mir macht es großen Spaß mit Musiker*innen zu spielen, die sich überhaupt nicht für Fehler interessieren. Denn das gibt einer Band viel mehr Power einfach drauf loszuspielen. Das finden wir alle am besten und, wenn wir auf der Bühne Spaß haben, überträgt sich das am Ende auch auf das Publikum.
Das fällt umso schwerer, wenn alles genau festgelegt ist oder, wenn jemand etwas zu schnell spielt und es anschließend heißt „du solltest mal wieder mit Metronom üben“. Dadurch geht die ganze Seele der Musik verloren. Natürlich mit dem Disclaimer, dass wir alle üben. Bei guten Musiker*innen setzt man dies aber eigentlich voraus.
Bei Aufnahmen ist es das Gleiche. Das, was man gerade spielt, ist eben das, was man gerade aufnimmt. Und, dass man dies nicht mehr ändern kann. Genauso wie man nicht mehr ändern kann, wie viele Jahre man bereits geübt hat. Sondern, dass man sich in dem Moment einfach selbst akzeptiert – vor allem auch das Level, das man aktuell hat, akzeptiert. Egal, ob das Amateur, Hobby-Musiker oder jemand, der in der Carnegie Hall spielt, ist. Ich glaube, dass geht alles auf einen bestimmten mentalen Prozess zurück, in dem man sich einfach akzeptiert. Wenn man sich dessen bewusst ist, und beginnt daran zu arbeiten, dann fällt einem Musik machen einfacher und man spielt besser.
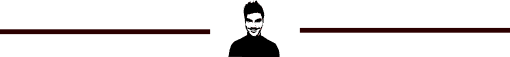

Werde Teil der 200+ Newsletter-Community und erfahre einmal im Monat neue Übe-Tipps & wer der nächste, spannende Podcast-Gast sein wird.
Könntest du bei dir beschreiben, wie du dieses Selbstbewusstsein gefunden hast?
Ich bin eigentlich extrem kritisch mit mir selbst und hatte lange Zeit Probleme mich in der Musik einfach fallen zu lassen. Gerade um auch auf das Studium zurückzukommen, weil dort eben alles bewertet wird. Oder die klassische Situation bei einem Gig, dass man im Publikum eine Person entdeckt, auf dessen Meinung man viel Wert legt und man das Gefühl hat, es dieser Person nun zeigen zu müssen.
Ich glaube, was mir vor allem viel geholfen hat war, dass ich zu allem immer ja gesagt habe, obwohl ich für manches noch nicht bereit gewesen bin. Dass heißt, wenn ich für Gigs mit schwierigem Material gefragt wurde, habe ich diese meistens alle angenommen.
Das hat mir auf jeden Fall geholfen in den verrücktesten Situationen Musik zu machen und diese Momente zu akzeptieren.
Also im Grunde sich selbst immer ins kalte Wasser zu werfen?
Genau. Vor allem auch dann Prüfungen (in der Hochschule) nicht als Prüfung wahrzunehmen, sondern als Konzert. Das ist auch genau das, was Keith Jarrett meinte. Das Publikum ist nicht da, du bist nicht da – das Einzige was da ist, ist die Musik. Das ist natürlich leicht gesagt jetzt.
Ich möchte jetzt keinen historischen Monolog präsentieren (lacht).
„Ich brauche diese Beschäftigung mit Musik auf der einen Seite, um das Gefühl zu haben, dass ich mein Handwerk unter Kontrolle habe. Und auf der anderen Seite, um das Gefühl zu haben, dass es weiter geht.“
(Christian Pabst)
Doch, gerne. Das hier wäre genau der richtige Zeitpunkt dafür.
Ich glaube da müsste man eher mal ein Sequel machen. Aber im Ernst. Mir macht es auch Spaß viel Über Jazz und Jazz-Geschichte zu lesen. Ich glaube, Jazz ist eine der Musikrichtungen, die am meisten missverstanden werden – sogar von vielen Musiker*innen.
Ich bin immer erschrocken, wie wenig Leute wissen, wo diese Musik genau herkommt und wie sie gewachsen ist. Eine Sache, die mir dabei die Augen geöffnet hat, habe ich in einem Buch über die afrikanischen Ursprünge des Jazz gelesen. Darin hieß es, Musik sei nicht da, um ein Konzert zu spielen, sondern um die Gemeinschaft zu stärken.
Das heißt, wenn die Leute anfangen zu singen, ist dies nicht dafür da, um etwas vorzuführen, sondern um die Gemeinschaft emotional zusammen zu schweißen. Ich finde, so müsste man eigentlich an jedes Konzert heran gehen.
Je mehr ich mich mit diesen Hintergründen der Musik beschäftige, umso leichter fällt es mir zu improvisieren und mit Lust und Laune zu spielen. Weil ich das Gefühl habe, dass es um mehr geht, als um die #11 über C7. (lacht)
Es nimmt vor allem den Druck aus der Musik heraus. Man bekommt nicht mehr Panik, wenn man im Publikum Keith Jarrett entdeckt und denkt, dass man ihm zeigen muss, was man die letzten 20 Jahre alles geübt hat. Sondern, dass es darum geht die Zeit mit den Leuten auf der Bühne, aber auch im Publikum, zu genießen.
Ich finde im besten Fall passiert dies auch bei Konzerten. Allerdings ist das Setting nie dafür ausgelegt, sondern der Zweck eines Konzertes ist ja meistens ein kommerzieller.
Ja, aber ich glaube die richtig großen Künstler*innen schaffen das. Bei den Musiker*innen, die ich bewundere sehe ich diese Offenheit, um mit dem Publikum, aber vor allen auch mit den Mitmusiker*innen etwas kreieren zu wollen.
Ich habe vor unserem Gespräch noch ein Video mit Chick Corea gesehen. Wenn er spielt, schaut er die ganze Zeit seine Mitmusiker an und gar nicht so sehr auf die Tasten. Sie halten dadurch durchgehend die Konversation am Laufen. Man merkt, dass es darum geht, die Menschen auf der Bühne zusammen zu schweißen, um etwas (musikalisch) Neues entstehen zu lassen. Diese Attitude fasziniert mich. Und wenn ich an die besten Konzerte denke, die ich je hatte, dann waren das genau solche.
Balbec – Das neue Album von Christian Pabst
Szenen vertonen – Inspiration für neue Musik
Was ich bei dir in der Vorbereitung spannend fand – und das bestätigst du gerade auch im Gespräch: Gerade kürzlich erschien dein inzwischen viertes Album „Balbec“ als Leader. „Balbec“ ist ja fiktive Badeort in Proust „Auf der Suche nach der verlorenen Zeit“. Hat dich in diesem Fall also konkret der Roman inspiriert?
Dank der Pandemie hatte ich plötzlich ganz viel Zeit und konnte endlich mal ein paar Bücher von meiner Leseliste abarbeiten. Und es hat sich so unfassbar gelohnt. Dadurch sind die ganzen Ideen für das neue Album gekommen.
Suchst du für dein künstlerisches Schaffen bewusst auch in anderen Sparten (bildende Kunst, Literatur) nach Inspiration?
Es ist nicht so, dass ich das bewusst mache. Dass ich bewusst sage „mal sehen was Marcel Proust so geschrieben hat, um daraus ein Stück zu machen“.
Meine Ideen für Stücke kommen tatsächlich nie von Musik. Das heißt, ich muss immer ein Bild vor Augen haben, oder eine bestimmte Szene, eine Stimmung um ein Stück zu kreieren. Ich versuche so intuitiv wie möglich zu komponieren. Bei dem letzten Album war das ganz schön, da ich die ganzen Szenen aus dem Buch in meinem Kopf hatte. Und vieles wurde zu einem Spiegelbild aus meinem privaten Leben.
Wenn ich dann eine musikalische Idee zu einer Szene im Kopf habe, schreibe ich sie meistens noch gar nicht direkt auf, sondern warte ein paar Tage. Wenn ich es dann immer noch höre, weiß ich, dass ich etwas gefunden habe. Erst dann schreibe ich es auf. Dann beginnt auch diese ganze musikalische Detailarbeit.
Das ist auch etwas, was man in der Musik hört. Sie kommt im besten Sinne des Wortes „einfach“ daher. Die Stücke sind sehr melodiös, aber gleichzeitig auch komplex. Aber diese Komplexität steht nie im Vordergrund. Und vor allen Dingen, dass es darum auch niemals geht finde ich sehr schön.
Dankeschön. Ich versuche anspruchsvolle Musik zu komponieren und zu spielen, die aber nie so wirkt.
Ich möchte Musik machen, bei der ich das Gefühl habe, dass jemand, der von Musik nichts versteht sie trotzdem genießen kann und in diesen musikalischen Sog gezogen wird. Genauso wie ein professioneller Musiker sich das anhört und interessiert feststellt, was noch alles unter der Oberfläche ist.
Bei all der Kunst, die mich anspricht, ist es ähnlich. Es gibt einen hohen Unterhaltungswert an der Oberfläche, aber darunter passiert ganz viel. Das macht die Beschäftigung mit einem Kunstwerk so spannend.
Vor allem beim Komponieren finde ich es wichtig, dass einen „Fluss“ gibt. Das die nächste Idee immer aus der vorherigen hervorgeht. An erster Stelle sollte immer die Emotion stehen, die man bei der Musik empfindet.
Ich finde das schließt auch ganz schön den Kreis zum Anfang unseres Gesprächs. Als wir darüber gesprochen haben, dass ein Teil deines Übens immer auch dieses freie Spielen ist.
Genau. Das sind auch die beiden Seiten, die wir im Laufe dieses Gespräch bereits angesprochen haben. Um so frei und kreativ loszuspielen und Ideen zu kreieren, muss man sich die ganze Zeit auch selbst mit Ideen füttern und hart arbeiten. So entstehen viel schneller Querverbindungen und Assoziationen. Das ist ein faszinierender Prozess finde ich.
Es ist super spannend dir zuzuhören. Wir könnten locker so noch eine Stunde füllen, aber ich möchte ganz allmählich den Hafen unseres Gesprächs ansteuern.
Wir müssen beide ja auch noch üben gehen (lacht).
„Das, was man auch live spielt, sollte beim Üben immer an erster Stelle stehen.“
(Christian Pabst)
Was lernst du gerade, was du noch nicht so gut kannst?
In der Tat. Aber vorher wollte ich noch Sport machen. Und das ist eine wunderbare Überleitung zur nächsten Frage: Wie erholst du dich ? Hast Du einen bewusst gewählten freien Tag in der Woche? Oder ist das möglicherweise sogar etwas, was dich dann stresst?
Mir fällt es sehr schwer mich zu erholen, weil ich mich immer auch ein wenig schuldig fühle, wenn ich nichts mache.
Wenn ich beispielsweise nach einer langen Tour nach Hause komme, fällt es mir sehr schwer länger als fünf Minuten ruhig zu sitzen. Einfach, weil ich mir dann denke, ich kann doch jetzt nicht hier sitzen und nichts machen (muss selbst lachen).
Aber inzwischen hilft mir meine Familie schon sehr, bewusst freie Tage festzulegen und alle Ablenkungen (Handy, Computer etc.) abzuschalten.
Und weil du gerade Sport erwähnt hast: Physische Betätigung ist in den letzten Jahren für mich auch viel wichtiger geworden. Ich war sonst immer eher ein Sportmuffel, aber ich habe gemerkt, wie wichtig es ist, um den Kopf auch wieder freizubekommen.
Es gibt jedenfalls wenige Tage im Jahr, an denen ich komplett nichts mache. Meistens schleuse ich dann doch noch die ein oder andere Email rein. Aber das ist auf jeden Fall etwas, an dem ich gerne arbeiten möchte.
Das greift gerade etwas meiner nächsten Frage vor: Was lernst (übst) Du gerade, was Du noch nicht kannst ? (darf auch gerne nicht-musikalisch sein)
Musikalisch kann ich das sogar konkret beantworten. Ich habe kürzlich ein neues Projekt mit einem italienischen Saxophonisten begonnen, der ganz tolle, moderne Musik schreibt. Allerdings ist fast jedes Stück entweder in 11/8 oder 13/8. Trotz allem muss ich wirklich sagen, dass die Musik immer fließt und kein „Hoplerstein“ ist.
In diesen Odd-Metern aber weiter fit zu werden, das ist etwas, an dem ich gerne weiter arbeiten möchte. Inzwischen habe ich 5er und 7er ganz gut unter Kontrolle. Aber auch in solchen ungewöhnlicheren Zählzeiten und Unterverteilungen möchte ich fit werden.
Ich arbeite daran, Musik mehr als einen Puls wahrzunehmen, anstatt sich an bestimmten Taktarten festklammern zu müssen.
„Ich möchte Musik machen, bei der ich das Gefühl habe, dass jemand, der von Musik nichts versteht sie trotzdem genießen kann und in diesen musikalischen Sog gezogen. Genauso wie ein professioneller Musiker sich das anhört und interessiert feststellt, was noch alles unter der Oberfläche ist.“
(Christian Pabst)
Hast du dazu eine bestimmte Technik?
Natürlich viel Odd-Meter spielen. Aber vor allem Phrasen spielen, die über den Taktstrich hinaus gehen.
Besonders bei Odd-Metern, indem man versucht Phrasen in 4 über einen 5/4 Takt zu spielen. Oder eine Dreier-Verschiebung über einen 5/4 Takt. Das ergibt am Ende die Freiheit. Man hört im Hintergrund läuft ein 5/4 Takt, aber man spielt bewusst darüber hinweg.
Welchen Tipp würdest Du Deinem jüngerem, Erstsemester-Musikstudenten-Ich gerne mitgeben, um den Du damals froh gewesen wärst ?
Nimm das alles nicht so ernst.
Besonders am Anfang als Erstsemester. Man nimmt unglaublich ernst was Dozent*innen, Kommiliton*innen oder das Publikum sagt. Da würde ich meinem jüngeren Selbst sagen, nimm das alles nicht so ernst und konzentriere dich auf die Musik, die du gern machen möchtest.
Weil davon bin ich auch wirklich überzeugt: Wenn man die Musik macht, die einem wirklich gefällt, wird auf jeden Fall etwas Gutes dabei herauskommen. Nicht nur musikalisch, sondern auch beruflich.
„Weil davon bin ich auch wirklich überzeugt: Wenn man die Musik macht, die einem wirklich gefällt, wird auf jeden Fall etwas Gutes dabei herauskommen. Nicht nur musikalisch, sondern auch beruflich.“
(Christian Pabst)
Wer schreibt hier eigentlich..?
Patrick Hinsberger studierte Jazz Trompete bei Matthieu Michel und Bert Joris und schloss sein Studium im Sommer 2020 an der Hochschule der Künste in Bern (Schweiz) ab.
Seit seiner Bachelor-Arbeit beschäftigt er sich intensiv mit dem Thema musikalisches Üben und hostet seit 2021 den Interview-Podcast "Wie übt eigentlich..?"



