Hören, Denken & Verstehen in Musik
Almuth Süberkrüb ist Professorin für Musikpädagogik und Leiterin des Studiengangs Elementare Musikpädagogik in Hamburg. Dazu ist sie Gründungsmitglied und Vorsitzende der Edwin Gordon Gesellschaft in Deutschland.

Edwin Gordon gilt als Begründer der Audiation – ich bin auf seine Music Learning Theory damals im Rahmen meiner Bachelor-Arbeit gestoßen. Seine Form des Unterrichtens rückt das Hören und Verstehen von Musik stark ins Zentrum und vergleicht das Musiklernen mit dem Erwerb der Muttersprache. Wie und, ob das funktioniert und was auditationsbasierten Unterricht ausmacht, das habe ich mit Almuth Süberkrüb besprochen.
Lieber hören statt lesen?
Die Folge mit Almuth Süberkrüb lässt sich auf allen bekannten Streaming Plattformen kostenlos anhören.
Spotify
Apple Podcast
YouTube
Das Interview mit Almuth Süberkrüb
Inhaltsverzeichnis
- Entweder-Oder-Fragen
- Aptitude – Das musikalische Potential
- Was ist Audiation?
- Anwendung der Audiation im Musikunterricht
- Outro
Die erste Frage, mit der es immer losgeht, lautet, vervollständigen Sie folgenden Satz. Üben heißt für Sie?
In Musik zu denken und das, auf das Instrument oder die Stimme, zu übertragen.
Welches Album, Musik oder Künstler, läuft bei Ihnen gerade in Dauerschleife?
Beim Hören ist es für mich wichtig, dass es ganz viele unterschiedliche Dinge sind: verschiedene Stile und auch Epochen. Insofern würde ich mich da jetzt gar nicht festlegen, sondern ich finde es wichtig, dass es eine große Vielfalt gibt.
Sie haben selbst Klavier und Gesang studiert. Gibt es denn für Sie jemanden, der auf ihr eigenes Spiel bezogen, ein Vorbild war?
Das ist total interessant. Für mich hat tatsächlich ein Umbruch stattgefunden, als ich Edwin Gordon kennengelernt habe – obwohl der mit meinen beiden Instrumenten gar nichts zu tun hatte.
Das hing auch damit zusammen, dass ich damals Schulmusik studierte und an einem Punkt war, dass ich dachte: Hat das, was in der Schule Musikunterricht heißt, tatsächlich etwas mit aktivem Musizieren zu tun? Es ging sogar so weit, dass ich überlegt hatte, das Studium zu beenden. Ich wollte nicht nur mit Kindern über Musik sprechen, sondern mit ihnen aktiv Musik machen. Dann habe ich Edwin Gordon kennengelernt. Er hat sehr viel in meinem Denken und Handeln, im musikalischen sowie im pädagogischen, verändert. Es ging plötzlich nicht mehr nur um ein Instrument oder die Stimme, sondern um die Musik überhaupt und darum, dass man durch eine Hörvielfalt ein großes Hörrepertoire entwickeln kann. Also wenn zum Beispiel jemand Tuba bei einem Trompetenlehrer lernt, dann entwickelt er ein bestimmtes Hörrepertoire. Das kann total spannend sein, weil natürlich die Tuba einen anderen Klang hat und auch eine andere Flexibilität benötigt. Und wenn man da eine Vielfalt an verschiedenen Instrumenten hörend wahrnimmt und kennenlernt, kann man auch auf seinem eigenen Instrument mehr von dieser Vielfalt umsetzen.
„Es ist spannend, wie sehr sich das in unsere Denkweise gearbeitet hat. Man hat das Gefühl, dass man immer wieder an den Punkt kommt, Noten zu benötigen. Gerade Menschen, die schon Erfahrung mit Noten haben, empfinden dies auch als einen Sicherheitsaspekt.
Almuth Süberkrüb
Das bedeutet aber gleichzeitig oft, dass das Hören nicht mehr so stark im Vordergrund steht, sondern eher das ‚mechanische Handeln‘.“
Entweder-Oder-Fragen
Um Sie als Person ein bisschen besser kennenzulernen, habe ich mir ein paar Entweder-Oder-Fragen überlegt. Sie haben einen Joker. Wenn Sie bei einer Sache sich nicht für eins entscheiden können, dürfen Sie den Joker ziehen. Schülerin oder Lehrerin?
Schülerin.
Lernen mit oder ohne Noten?
Ohne Noten.
Das ist spannend. Bei Edwin Gordon, ich reiße die Theorie nur ganz kurz an, gibt es die These von“ sound before sight“, die sagt, dass man erst den Klang haben muss, bevor man in das Dekodieren von Noten gehen kann. Das kann aber in der Praxis unter Umständen relativ schwierig sein, wenn man Schülerinnen und Schüler hat, bei denen die Eltern das Notenlernen wünschen. All das hat darüber hinaus auch Einfluss darauf, wie ich Unterricht gestalte: Ich kann nicht mehr eine Instrumentalschule nehmen und Seite 1 aufschlagen. Ich muss mein Unterrichtskonzept komplett neu denken, oder?
Ja, und ich muss auch mein eigenes Lernen mit umdenken. Das kommt ebenfalls noch hinzu. Die meisten haben zuerst mit Noten gelernt. Ein Freund hat diese Vorgehensweise vor längerer Zeit mal in der Schule ausprobiert. Wir haben dann immer telefoniert und er berichtete, wie er gerade seinen Unterricht gestaltete. In jedem Telefonat kam am Ende die Frage auf, ob denn in der nächsten Stunde die Noten eingeführt werden würden. Er wusste nicht mehr, was er noch ohne Noten machen konnte. Wir haben dann immer gemeinsam überlegt, was eigentlich gerade Stand ist und wo die Schüler:innen stehen bzw. was sie brauchen. Und am Ende des Telefonats fanden wir dann immer noch weitere Übungen, die keine Noten benötigten. Es ist spannend, wie sehr sich das in unsere Denkweise gearbeitet hat. Man hat das Gefühl, dass man immer wieder an den Punkt kommt, Noten zu benötigen. Gerade Menschen, die schon Erfahrung mit Noten haben, empfinden dies auch als einen Sicherheitsaspekt. Da weiß man, was man hat. Ich weiß, wenn ich den schwarzen Punkt auf der Linie sehe, dann drücke ich die Taste oder dann muss ich die Seite an der und der Stelle drücken oder Ähnliches.
Das bedeutet aber gleichzeitig oft, dass das Hören nicht mehr so stark im Vordergrund steht, sondern eher das „mechanische Handeln“. Zudem stellt sich die Frage, wann was wichtig ist. Wann ist das Hören hilfreich? Wann ist vielleicht das Nachsingen oder das Nachspielen hilfreich? Und wann ist es auch mal hilfreich und notwendig, ganz bestimmte technische Aspekte entweder in Stücken isoliert zu üben?
Wahrscheinlich auch immer abhängig davon, wo die Schülerin bzw. der Schüler gerade steht und, ob das Bedürfnis da ist mit anderen zusammen zu spielen. Dann wäre es Voraussetzung zumindest Noten verstehen zu können, um mit anderen zusammen musizieren zu können.
Ja, richtig. Das ist die Frage nämlich: wann brauchen wir denn überhaupt Noten? Wie lang kann es gehen ohne? Und es gibt ja große Musiker, die gar keine Noten lesen können. Und trotzdem sind es genau solche Punkte natürlich. Wenn ich in einem Ensemble mitspielen möchte und ich kann mit den Noten, die das Ensemble nutzt, nichts anfangen, dann habe ich ein Problem. Dann kann ich nicht mitspielen. Wobei man auch mit Schülern in einer großen Gruppe ohne Noten üben und spielen kann – selbst in Konzerten. Wenn Schüler:innen über den Körper mal den Unterschied zwischen einem Zweier-Metrum und einem Dreier-Metrum erfahren haben, dann können sie es auch spielen.
Da sind wir schon mitten in der Theorie von Gordon: Das Verstehen der Musik wird mit einbezogen und nicht nur das bloße Nachspielen. Aber gleich dazu mehr. Wir sind ja heute in Hamburg, deshalb kam mir ja im Zug die Frage in den Kopf: Nordsee oder Alpen?
Oh, beides. Das ist mein Joker.
Das ist der Joker? Okay, dann bin ich gespannt auf die letzten beiden Fragen, die noch kommen. Wenig und oft oder selten und viel?
Wenig und oft.
Talent oder Fleiß?
Ich bräuchte noch einen Joker.
Aptitude – Das musikalische Potential
Die Frage ist auch ein bisschen gemein. Sie kam mir, als ich den Begriff der Aptitude gelesen habe. Wenn ich es richtig erkläre, dann sagt Gordon, dass im Alter von neun Jahren Kinder ihr musikalisches Potential erschöpft haben – ganz vereinfacht gesagt. Ist das noch Stand der Forschung? Kann man das überhaupt so sagen, oder ist das zu stark vereinfacht?
Das ist so etwas missverständlich. Wenn wir geboren werden, haben wir ein bestimmtes Aptitude – also wir haben eine bestimmte Voraussetzung. Diese entwickelt sich im Laufe der Jahre weiter oder zurück, je nachdem wie wir es nutzen und, wie der Einfluss. Das heißt: Wenn ein Kind in einem Kontext aufwächst, in dem es nie Musik hört, es aber eigentlich alle Voraussetzungen hätte, um ein hohes Potential zu entwickeln, dann ist es wahrscheinlich, wenn es fünf bis neun Jahre ist, dass es kein besonders hohes Aptitude haben wird. Das heißt, in dieser Phase des frühkindlichen Lernens (bis neun Jahre ungefähr) geht es darum, dass man ein möglichst großes Angebot macht, um die Chance zu geben, dass das, was wir als Potenzial haben, musikalisch genutzt oder ausgebaut wird.
Es geht gar nicht darum zu sagen, dass ein Kind mit z.B. sechs Jahren bestimmt ein hohes Aptitude hat, das es nun nutzen sollte. Sondern es geht eher darum zu sagen, dass eine breite Unterstützung und ein breites Angebot wichtig sind, damit das musikalische Begabungspotenzial (was Aptitude ja heißt) sich überhaupt entwickeln und aufrechterhalten werden kann. Und dann kommt tatsächlich irgendwann ein Punkt, an dem es sich verfestigt.
Nehmen wir mal an, dieser Punkt ist erreicht und es gibt eine Person, die ein tonale Aptitude im 90. Perzentil und rhythmisch im 95 Perzentil (fiktive Werte) hat. Und eine andere Person hat tonal eine Aptitude im 50. Perzentil und rhythmisch im 70. Perzentil. Dann heißt es nicht, dass die erstgenannte Person besser Musik lernt. Es heißt nur, dass diese Person ein höheres Potenzial hat, aus dem sie schöpfen kann.
Ich habe das selbst mal in einem Kurs mit einem Blechbläser erlebt. Man würde hier ein hohes Potential vermuten, da sie den Ton vorher selbst hören müssen, wofür ein hohes Potential sehr wichtig ist. Die Tests haben dann allerdings bei dieser Person ein sehr niedriges Potential ergeben. Und das Interessante war, dass es keiner gehört hat. Die Person hat einfach so intensiv geübt und so kontinuierlich seine Möglichkeiten weiterentwickelt, dass es nicht automatisch heißt, dass sie nicht in der Lage sein wird, bestimmte Dinge am Instrument zu tun. Und das ist, finde ich, etwas sehr Wichtiges: Einerseits bereit sein zu sagen, wir geben ganz viel Energie (an pädagogischen Impulsen) in dieses junge Alter. Und gleichzeitig wissen wir aber, dass es in der Realität bei den Kindern doch nicht so ankommt, wie es so schön auf dem Papier steht.
Das heißt, diese Aptitude ist am Ende eigentlich nur ein Hilfswerkzeug für Lehrer:innen, um erstmal Potential festzustellen?
Ja, das sehe ich auch so. Aber es gibt da viele Unterschiede. Ich habe da mal einen Versuch gemacht, das war ganz spannend. Ich sollte in Österreich mal für eine sehr, sehr große Gruppe an Lehrern unterrichten. Ich kannte die Kinder vorher nicht und umgekehrt. Zudem kannten die Kinder die Vorgehensweise nicht. Also es waren schon ziemlich viele Unbekannte. Ich hatte vorher überlegt, wie ich es hinkriege, dass ich trotzdem in dieser dreiviertel Stunde diesen erwartungsvoll dasitzenden Lehrern ein bisschen, von dem was möglich ist, zeigen kann. Und dann habe ich die Lehrer dieser Schüler:innen gebeten, diesen Aptitude-Test für diese Altersgruppe mit ihnen zu machen, mir zu schicken, und ich habe ihn dann ausgewertet. Aus pragmatischen Gründen habe ich die Schüler:innen so gesetzt, dass auf der einen Seite welche saßen, die rhythmisch sehr stark waren, auf der anderen Seite tonal. Ich wusste, ich kann dann gezielt dort entsprechenden Input reingeben und mit ein bisschen Chance kommt auch etwas zurück. Das hat im Prinzip auch gut funktioniert. Im Nachgespräch kam dann auch eine Frage zu Aptitude. Ich sollte sagen, welches der Kinder ein hohes Potential hätte. Ich habe das abgelehnt, aber vorgeschlagen, dass ein Lehrer doch dies beantworten könne. Die Stimme aus dem Publikum war überzeugt, dass man dies auch ohne Test feststellen könne. Also hat dieser Lehrer einen Schülernamen genannt, und ich habe dann nachgeguckt. Das Interessante war: B ei einem dieser Schüler*innen stimmte es, bei zwei stimmte es nicht. Und bei einem, bei dem ich dann gesagt habe, der hat sicher ein sehr hohes Potenzial, da meinte der Lehrer, dass dies nicht sein könne, weil er nur Quatsch macht.
Das heißt: Wenn ich das weiß, kann ich diesen Test wirklich als Werkzeug nutzen. Ich weiß dann, dass der, der Quatsch macht, mehr gefordert werden möchte. Umso größer die Gruppe, umso schwerer fällt es zu unterscheiden, ob jemand Quatsch macht weil er unter- oder überfordert ist.
Und wenn ich weiß, eine Schüler:in hat ein hohes Potenzial im tonalen Bereich, dann weiß ich, wie weit ich diese Schüler:in fordern und fördern kann. Ich kann dann differenziert unterrichten und alle auf ihrem Level fördern. Und dadurch lernen ja nicht nur die, die zum Beispiel dann improvisieren. Sondern diejenigen, die Harmoniegrundtöne singen, lernen durch die Improvisation der Anderen genauso viel. Sie setzen unbewusst das, was die anderen machen, ständig in einen Bezug zu dem, was sie singen.
Jetzt sind wir ja schon mitten in der Methode und eigentlich auch schon an einem sehr tiefen Punkt, nämlich bei ganz konkreten Übungen. Ich würde gerne nochmal einen Schritt zurück gehen und eine allgemeine Definition von Audiation versuchen aufzustellen. Wie würden Sie Audiation in einem oder zwei Sätzen versuchen zusammenzufassen?
„Das heißt, Audiation bedeutet, ich höre es im Kopf vor, ich weiß im Grunde, was da passieren soll oder wird oder passiert ist. […] Wenn wir hier von Verstehen sprechen, meinen wir, wenn ich zum Beispiel ein Musikstück höre, dass ich weiß, in welchem Metrum, Tonalität, oder welche formalen Besonderheiten (Stilrichtung etc.) erklingen. Also all die Dinge, die wichtig sind, um umfassend musizieren zu können.“
Almuth Süberkrüb
Was ist Audiation?
Audiation ist Hören und Verstehen von Musik, die nicht oder nicht mehr erklingen muss, aber kann.
Also die entweder aktuell in unserem Kopf stattfindet oder draußen wirklich hörbar ist?
Ja, oder hörbar war oder hörbar sein wird, wenn ich sie spiele. Also wenn ich zum Beispiel mein Instrument im Kopf habe, dann spielt oder singt es im Grunde das vor, was nachher durch das mein Instrument verklanglicht wird. Wenn ich das im Kopf nicht habe, dann ist es schwer möglich, Musik zu spielen, die über die Ebene des rein technischen (im Sinne von griffbezogen) hinausgeht.
Das heißt, Audiation bedeutet, ich höre es im Kopf vor, ich weiß im Grunde, was da passieren soll oder wird oder passiert ist, kann Entscheidungen treffen und kann dann entsprechend musikalisch agieren. Wenn wir hier von Verstehen sprechen, meinen wir, wenn ich zum Beispiel ein Musikstück höre, dass ich weiß, in welchem Metrum, Tonalität, oder welche formalen Besonderheiten (Stilrichtung etc.) erklingen. Also all die Dinge, die wichtig sind, um umfassend musizieren zu können. Und all das bedeutet bei der Audiation Verstehen. Das heißt, es geht nicht nur um syntaktische oder theoretische Phänomene, sondern es geht um das allgemeine Verstehen.
Vielleicht ist ein ganz guter Vergleich, wenn wir uns jetzt unterhalten, dann sage ich bestimmte Sachen zur Audiation und Sie überlegen weiter und denken: „Hab ich das schon mal gehört? Wo kann ich denn da anknüpfen? Ach ja, der und der hat das auch gesagt, aber es ist ein bisschen anders.“ Sie wägen ab und schauen, wie es sich von anderen Dingen unterscheidet. Dann werden sie wahrscheinlich ihre Netzwerke nach Sachen durchforsten, wo sie sagen, „Da reibt sich etwas, das sehe ich aber jetzt anders – da muss ich doch nochmal nachfragen.“ Und wahrscheinlich werden Sie auch weiterdenken und überlegen, worauf läuft das denn jetzt alles hinaus? Was ist denn das Ziel des Ganzen? Und wenn Sie all das jetzt tun, dann sprechen wir davon, dass sie denken. Und wenn Sie all diese Komponenten im musikalischen Mitdenken, dann spricht man von Audiation. Also es ist im Grunde ein Denken in Musik.
Da gibt es doch auch von Edwin Gordon den schönen Satz, „Audiation is to music what thought is to speech.“
Genau, der würde da gut passen.
Das ist eigentlich ganz schön, dass Sie gerade versucht haben, mir Audiation mit dieser Konversationsebene zu erklären. Ich bin in der Vorbereitung oft auf diesen Vergleich gestoßen, dass Musiklernen (im Sinne der Audiation) vergleichbar wäre mit dem Erwerb der Muttersprache. Beides ist am Anfang sehr informell und unstrukturiert. Man bekommt das einfach im Umfeld mit. Die Frage, die ich mir dann gestellt habe: Ist überhaupt das so möglich? Am Ende ist das fast schon eine strukturelle Frage. Weil, wenn man es nur in einer Blase machen würde, dann käme diese ja immer dann wieder an Grenzen, wenn ihr Umfeld nicht auf diese Art und Weise lernt. Wir hatten vorhin bereits das Beispiel mit dem Ensemblespiel. Also die erste Frage wäre: Kann man Musik wie eine Sprache erlernen? Und die zweite Frage: Das ist ja alles noch informell. Wie bekommt man dann Struktur in so etwas rein?
Ich fange mal an bei der Frage, ob das möglich ist? Ich würde sagen: Ja, auf jeden Fall. mit Im Prinzip geht es bei dem Gedanken darum, dass zunächst ein Kontext geschaffen wird. Dass in diesen Kontext Details eingebettet werden und, dass über diese Schritte zum nächsten Schritt gegangen wird, den Kontext neu zu lernen.
Um es konkret zu machen: Wenn ein Kind geboren wird, dann befindet es sich immer in einem Raum mit Menschen. Diese Menschen sprechen, streiten, freuen, lachen, diskutieren. Sie sprechen über hochkomplexe Dinge. Eltern fangen nicht an, in dem Moment, wo ein Baby geboren wird, nur noch in Drei-Wortsätzen zu sprechen. Niemand erwartet, dass dieses daliegende Baby alles hört und versteht, sondern es wird eigentlich nur gebadet in diesen verschiedenen Sprachlichkeiten. Und dadurch können Kinder ein großes Hörrepertoire anlegen, ohne dass irgendwas erwartet wird. Kein Vater, keine Mutter würde bei einem zwei Monate alten Kind hingehen und sagen, wir müssen jetzt wirklich mal üben, dass du Kindergarten sagen kannst. Das fänden alle absurd. Aber in der Musik, da ist es nicht so absurd. Wenn man diese Haltung auf das Musiklernen übertragen kann und den Kindern die Chance gibt, dass sie hören dürfen und den Eltern die Chance gibt, zu lernen, wie sie auf ihre Kinder eingehen können und das weiter unterstützen, dann ist das ein riesengroßer Schritt für alle.
Im sprachlichen Bereich wissen wir, wie wir darauf eingehen. Das Kind sagt vielleicht „Au. Ein Auto fährt vorbei und wir sagen einfach mal Auto. Entweder es stimmt oder es stimmt nicht. Das Kind reagiert vielleicht, indem es sich abwendet. Dann hat es doch etwas anderes gemeint. Oder das Kind schaut mich nochmal an und möchte mehr haben. Auf diese spielerische Weise lernen Kinder ihre Sprache. Und das geht in der Musik auch.
„Eltern fangen nicht an, in dem Moment, wo ein Baby geboren wird, nur noch in Drei-Wortsätzen zu sprechen. Niemand erwartet, dass dieses daliegende Baby alles hört und versteht, sondern es wird eigentlich nur gebadet in diesen verschiedenen Sprachlichkeiten. Kein Vater, keine Mutter würde bei einem zwei Monate alten Kind hingehen und sagen, wir müssen jetzt wirklich mal üben, dass du Kindergarten sagen kannst. Das fänden alle absurd. Aber in der Musik, da ist es nicht so absurd.“
Almuth Süberkrüb
Das ist auch eine Frage, die ich mir in der Vorbereitung überlegt habe. Ist die Audiation hauptsächlich eine Herangehensweise für Kinder? Weil dieses Baden in Musik, wie Sie es gerade so schön beschrieben haben, das stelle ich mir bei einem Erwachsenen Schüler relativ schwierig vor. Der hat im Zweifel schon 40 Jahre an Hörgewohnheiten hinter sich, ohne die eingestuft bekommen zu haben. Beziehungsweise erwartet man von ihm auch etwas anderes.
Ich bleibe mal in dem Bild: Erwachsene haben sich schon an ihren eigenen Badeduft und ihre eigene Badetemperatur gewöhnt. Und wir Menschen sind ja Gewohnheitstiere. Das ist übrigens interessant, auch Musiklehrer haben ja so ihre eigene Badetemperatur und ihren eigenen Badeduft. Das heißt aber nicht, dass wir dabei bleiben müssen. Und musikalisch, ich finde das ganz wichtig, dass Sie das ansprechen, sollten wir nicht vom biologischen Alter sprechen, sondern vom musikalischen Alter und das unterscheidet sich.
Es gibt Erwachsene, die kommen mit ihren Kindern in eine Eltern-Kind-Gruppe und sind musikalisch ähnlich wie ihr Kind im Brabbelalter. Und es gibt andere, bei denen ist das anders. Das heißt, je nachdem, wie viel wir im Leben an Musik gemacht haben, wie viel wir erleben durften, gelernt haben, befinden wir uns in einem unterschiedlichen Grad an musikalischem Alter. Und das ist unabhängig von meinem biologischen Alter.
Ich habe dazu auch ein Beispiel: Ich hatte mal eine Improvisationsgruppe, in der es eine Klarinettistin gab. Alle Personen in der Gruppe waren auf sehr unterschiedlichem Niveau. Es gab welche, die sich bereits mit Jazz-Improvisationen beschäftigt haben und es gab andere, die eher aus der Klassik kamen. Also es war eine sehr bunte Gruppe mit sechs Schüler:innen. Und da gab es eine Klarinettistin, die sehr wenig Erfahrung hatte. Ich war am Anfang skeptisch, wie wir die Gruppe zusammen bekommen sollten. Ich fing mit einer einfachen Übung an: Jeder sollte einen Ton spielen und ihn anschließend nachsingen. Die Klarinettistin meinte daraufhin, dass sie das nicht könne. Das sind natürlich wenig Voraussetzungen, um zu improvisieren. Gleichzeitig dachte ich, dass sie ja aus irgendeinem Grund hier ist. Ich habe dann mit ihr gesprochen und ihr vorgeschlagen, dass wir uns einfach mal alleine treffen könnten. Sie stimmte zu.
Als wir uns dann getroffen haben, habe ich gesagt: „Ich weiß, was ich mit dir machen kann. Das fühlt sich aber für dich vielleicht ein bisschen komisch an. Ich würde dir einfach erstmal was vorsingen und du hörst einfach mal zu.“ Und dann haben wir uns jede Woche getroffen und ich habe eine halbe Stunde Lieder in allen Tonalitäten und Metren für sie gesungen. Und dann habe ich irgendwann das Ende herausgezögert und habe den Tonalitätsgrundton erstmal weggelassen und dann gesungen. Und irgendwann hat sie gesagt, dass sie ihn gern singen möchte. In dem Moment wusste ich, dass sie unbewusst alles, was sie vorher gehört hat, auf diesen Ton beziehen kann, denn sonst könnte sie ihn nicht singen. Dieser Ton ist das Fundament dieser Tonalität. Und das ist ein ganz wichtiger Schritt. Von da ausgehend sind wir schrittweise weitergegangen. Und das ging sehr gut, weil sie sich darauf eingelassen hat. Und weil sie über ihren Schatten gesprungen ist und etwas erreichen wollte.
Nach einem Jahr gab es dann ein Schülerkonzert, bei dem wir zwei Impro-Stücke spielten. Beim zweiten Stück fing der Gitarrist an zu spielen und merkte, dass er den Capo vergessen hatte abzumachen. Die Klarinettistin spielte ihren ersten Ton und ich erschrak. Das Interessante war allerdings, dass sich beide angeschaut haben und die Klarinettistin ihre Grundidee weiterspielte, während der Gitarrist den Capo abmachte. Und ich dachte so, wow. Nach dem Konzert sagte sie mir, dass sie von der Situation gar nicht so geschockt war. Sie wusste, dass ihr etwas einfallen würde, was sie spielen kann. Und das fand ich total toll.
„Und musikalisch, ich finde das ganz wichtig, dass Sie das ansprechen, sollten wir nicht vom biologischen Alter sprechen, sondern vom musikalischen Alter und das unterscheidet sich.“
Almuth Süberkrüb
Das knüpft eigentlich ganz schön an meine nächste Frage an. Denn was ich so gut bzw. so logisch an der Gordon-Methode finde, ist dieser stufenweise Aufbau. Man springt, wenn man das Wort benutzen möchte, von Level zu Level, von Stufe zu Stufe. Und ich habe mich gerade auch in der Vorbereitung gefragt, was mache ich, wenn jemand, zum Beispiel etwas nicht nachsingen kann. Das heißt, die Konsequenz ist dann immer eine Stufe zurückzuspringen und zu schauen, ob die Person bspw. den Grundton hören kann. Und erst dann gehen wir wieder zur Nachsingen-Stufe.
Wenn man es ganz allgemein fassen würde: Überlegen Sie sich, welche Voraussetzungen die Schüler:innen brauchen, um das lernen zu können, was sie vermitteln wollen. Das klingt einfach, ist es aber nicht immer.
Ja, das kennt jede*r Musiklehrer*innen aus dem eigenen Unterricht. Man verzweifelt manchmal fast schon, wenn man etwas vorsingt, und die Schüler*in kann es nicht nachsingen. Wenn dann das Wissen fehlt, dass der Schülerin oder dem Schüler gerade die Voraussetzungen dafür fehlen, das überhaupt nachzumachen, sucht man den Fehler ja vergeblich an Stellen, wo er gar nicht sein kann.
Ja, genau. Und es gibt ja genug Möglichkeiten, woran es liegen kann.
Und das ist auch nochmal wichtig zu sagen: Natürlich sind alle Aspekte wichtig, auch die Stilrichtungen. Aber der systematische Aufbau bezieht sich nur auf tonale und metrisch-rhythmische Aspekte. Gordon ging davon aus, dass man in dem Moment, wo man bestimmte tonale und rhythmische Patterns kann, diese auch in verschiedenen Stilrichtungen anwenden kann. Schließlich gibt es auf der Welt nicht unendlich viele Patterns, die genutzt werden. Und gerade im Schülerbereich gibt es ja nochmal weniger als im Profibereich. Und wenn man diese Patterns gut verinnerlicht hat, dann ist der Schritt, sie in unterschiedlichen Stilrichtungen zu verwenden, relativ klein. Wenn man sie aber gar nicht kann, fehlt einem etwas.
Lernmuster und -Systeme haben auch immer etwas Vereinfachendes, was sie problematisch macht. Das heißt, es geht bei dieser Stufung im Grunde darum, dass man Schritt für Schritt geht, aber dass man auch mal Sprünge wagt. So wie im echten Leben. Und wenn man dann auf die Nase fällt beim Sprung, wenn man vielleicht doch einen zu großen Sprung gewagt hat, dann weiß man, es liegt nicht daran, weil ich gar nichts kann. Sondern ich weiß, dass ich doch noch mal auf die Stufe zurück gehen sollte, von der ich abgesprungen bin. Dann ist die Chance durchaus größer, den großen Sprung danach auch zu schaffen. Und diese Sprünge, die sind total wichtig. Und ich finde, dieses System gibt die Chance, Schritt für Schritt zu gehen und damit eine Sicherheit zu haben und gleichzeitig auch mal risikobereit zu sein. Also zu sagen: „Okay, meine Schüler:innen können jetzt zwei Patterns und ich improvisiere mit denen jetzt mal.“
Unterscheidungs- vs. Inferenzlernen
Bei den Sprüngen ist noch eine Sache sehr wichtig. Es gibt beim auditionsbasierten Musiklernen überbrückende Lernbewegungen. Das heißt, wir haben diese Systematik und es ist eingeplant, dass es Sprünge vom Unterscheidungslernen zum Inferenzlernen gibt.
Ganz kurz zur Erklärung: Beim Unterscheidungslernen wird den Kindern immer die Antwort mitgegeben. Das heißt, ich singe als Lehrer ein Pattern vor und wenn das Kind oder der erwachsene Schüler das nachsingt, singe ich mit. Das heißt, ich stelle nicht irgendwelche Fragen und erwarte irgendwelche Antworten, sondern ich frage, um zu vermitteln. Und wenn ich dann spüre, dass es gut klappt, dann fordere ich das nächste Mal zum solistischen Singen auf. Und dann ist das Pattern für diese Person ein vertrautes Pattern. Das ist ganz grob und sehr vereinfacht gesagt, das Unterscheidungslernen.
Inferenzlernen ist ein anderer Block, bei dem es darum geht, aus den Inhalten, die ich im Unterscheidungslernen gelernt habe, schrittweise auch selbstständig neue Inhalte abzuleiten. Es ist das, was man in der Schule früher als den Transfer bezeichnet hat. Dieses Transferdenken kommt oft viel zu spät. Denn wenn ich das übe, dann fange ich an, ganz anders zu denken. Und dann ist auch das Risiko des woanders Hinspringens, nicht mehr so groß. Das Springen ins Transferdenken/Inferenzlernen kann bereits ganz früh anfangen. Leider findet es im Lernen oft viel zu spät statt, was sehr schade ist.
Das klingt auf jeden Fall auch sehr spielerisch (à la exploratives Lernen). In der letzten Podcast-Folge war Wolfgang Schöllhorn zu Gast, Trainingswissenschaftler aus Mainz. Er hat über das Differenzielle Lernen gesprochen. Und das Unterscheidungslernen hat mich sehr daran erinnert, als ich es in der Vorbereitung gelesen habe. Wir hatten das Beispiel mit dem Zweier- und Dreierpuls bereits. Zu wissen, wie sich eins der beiden anfühlt, hilft mir zu differenzieren was, was ist. Von daher finde ich es ganz schön, dass sich hier nochmal ein kleiner Kreis schließt. Das Unterscheidungslernen ist sozusagen das Fundament. Und darüber gibt es mit dem Inferenzlernen nochmal eine nächste Stufe.
Ich überlege gerade. Das ist ganz spannend. Die Frage war aber etwas lang.
Die Frage ist auch eigentlich keine richtige Frage, wenn man so möchte. Ich muss vielleicht ein bisschen ausholen: Ich habe über die Audiation meine Bachelorarbeit damals geschrieben. Ich mir Jazz-Improvisationen in der Audiation und im Flow angeguckt und war sehr begeistert. Ich habe zuerst in Saarbrücken studiert und kam dann ins zweite Jahr an die Hochschule in Bern. Dort war es im ersten Jahr Aufgabe, Kinderlieder in anderen Modi zu singen. Meine ersten vier Wochen im Unterricht bestanden also darin, mir zwölf Kinderlieder zu notieren und diese in allen Modi zu üben. Das hat damals mein Leben ein bisschen verändert, wenn man so das so hoch sprechen möchte. Was ich dann während der Bachelorarbeit so spannend fand, ist, dass ohne, dass wir es im Unterricht Audiation genannt haben, die Prinzipien ganz ähnlich waren.
Das gleiche Erlebnis hatte ich nun mit dem Unterscheidungslernen und dem Differenziellen Lernen von Wolfgang Schöllhorn. Da verband sich für mich schon wieder ein Punkt. Am Ende sind es von der gleichen Sache lediglich verschiedene Betrachtungsweisen, die auf verschiedenen Wegen zum gleichen Ziel zu führen. Ich finde es immer spannend, das im Podcast herauszuarbeiten.
Das sind ja so grundsätzliche Lernprinzipien, die ganz viel verwendet werden. Also was ich so hilfreich finde an dieser Stufung, die Gordon entwickelt hat, ist, dass er Wissen aus verschiedenen Bereichen so gebündelt und strukturiert hat, dass ein musikalischer Lernprozess entstehen darf, der so stattfindet, wie es dem menschlichen Lernen entspricht. Das heißt, da wurde nicht alles neu erfunden. Also zum Beispiel die Verwendung von Solmisationssilben. Oder was Sie gerade erzählt haben, finde ich ganz spannend. Gordon kam ja auch aus dem Jazz und das merkt man auch an bestimmten Sachen immer wieder. Und es gibt ja auch von den Dozent:innen, die zum Beispiel in den USA unterrichten, einige, die im Jazz beheimatet sin. Aber im Grunde kommt diese Herangehensweise eher aus dem Jazz als aus der Klassik. Obwohl sie überall anwendbar ist.
Was sicher auch an unserer Tradition des Musikvermittelns liegt. Wenn man zurückguckt zu Beethoven, war es nicht üblich, dass Kadenzen aufgeschrieben wurden. Sie wurden damals improvisiert. Oder auch im Barock. Das heißt, dieses fixiert sein auf die Noten und davon ausgehen müssen im Lernprozess, das ist etwas, was sich später entwickelt hat. Wenn man keine Noten verwendet ist man mehr ins Hören gezwungen. Weil das Medium, was uns sehr vertraut ist (weil wir es ständig inn unserem Alltag benutzen) uns weggenommen wird: nämlich das Lesen.
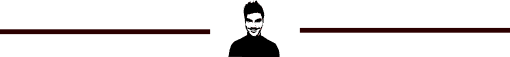

Werde Teil von 100+ Abonnent*innen
In meinem High Five Newsletter empfehle ich einmal im Monat spannende Artikel rund um das Thema Üben. Ihr erhaltet spannende Hintergrund-Infos rund um den Podcast und wisst bereits vorab, wer meine nächsten Gäste sind. Dazu gibts Bücher- und Musiktipps. Alles natürlich kostenlos.
Anwendung der Audiation im Musikunterricht
Vielleicht können wir, um das Ganze ein bisschen abzurunden und den Leuten auch etwas Konkretes mitzugeben, mal gucken, was denn typische Anwendungsbeispiele im Unterricht wären? Wir hatten ja vorhin schon dieses Baden im Hören als erste Stufe. Was, wenn man jetzt nicht Audiationslehrer/ -lehrerin ist, erstmal auch ein Schritt ist, das wirklich organisch in den Unterricht einzubinden. Was wären typische Übungen oder wie sähe eine idealtypische Audiation (Music Learning Theory) Unterrichtsstunde aus?
Ich möchte ganz kurz noch etwas zu den Liedern sagen: Wenn möglich sollten die Lieder und Sprechgesänge ohne Text gesungen werden. Das ist noch etwas, was für viele sehr ungewohnt ist. Natürlich variiert es ein bisschen abhängig von der Altersstufe. Also bei ganz kleinen Kindern ist es völlig problemlos. Wenn die dann ein bisschen älter werden fordern sie auch ein bisschen mehr Text. Das macht es ein bisschen leichter. Das Prinzip ist zu gucken, wie kann ich mit möglichst wenig Text und viel Musik arbeiten.
Tonalitätsgrundton finden und singen
Jetzt aber noch mal zur anderen Frage. Nehmen wir mal an, das hat stattgefunden: Man hat die Möglichkeit ganz viel in verschiedene Metren und Tonalitäten zu hören und möchte jetzt mit Patterns arbeiten. Dann ist eine wichtige Voraussetzung erstmal, dass ich in der Lage bin den Tonalitätsgrundton zu finden. Wenn ich ihn finde, dann habe ich im Prinzip den tonalen Rahmen des Liedes unbewusst verstanden. Das ist ein ganz wichtiges Fundament, um weiterzukommen.
Raumfüllende Bewegungen
Eine zweite Sache ist, wenn ich im rhythmischen Bereich arbeite, dass ich in der Lage bin, fließende, raumfüllende Bewegungen auszuführen. Das heißt, dass ich den Raum, den ich habe, überhaupt erstmal wahrnehme und erfahre. Das unterstützt mich dabei, auch in der Musik diese Räume zuzulassen und wahrzunehmen.
Koordinationsfähigkeit Arme – Beine
Dann ist es sehr wichtig, dass eine Koordinationsfähigkeit von Beinen und Armen vorhanden. Das heißt, dass ich Hauptpuls mit den Beinen empfinden kann und gleichzeitig mit den Armen Unterteilungen ausführen kann. Wenn ich diese Koordination habe, dann habe ich auch ein Fundament für bestimmtes rhythmisches Lernen. Diese Hauptpulse (Makrobeats) bilden das rhythmische Fundament unserer Musik. Und die Mikropulse oder Unterpulse, die geben die zwischenstrukturelle Ebene.
Hinweis: Auch im Anfängerunterricht, gibt es diesen Stufenweisen Aufbau. Offbeatts, so wie sie im Podcast als Beispiel gezeigt sind, folgen erst später.
Also ich lerne Schritt für Schritt und erst lerne ich übers Hören und Wiedergeben. Also ich höre etwas und singe das Gleiche nach, dann verbinde ich das mit Solmisations- oder Rhythmussilben, um dem, was ich vorher allein hörend verstanden habe, eine zweite strukturelle Ebene zu geben. Dann bette ich es in einen größeren Kontext ein, das ist die dritte Stufe. Dann beginne ich, das, was ich vorher gehört habe, was ich mit Rhythmus oder tonalen Silben verbunden habe, in Noten zu lesen. Das heißt, die Patterns werden nicht beliebig aneinandergereiht, sondern es gibt eine bestimmte Abstufung. Ich fange nicht mit Offbeats an, sondern mit Makros und Makro-Mikro-Verbindungen. Diese baue ich dann immer weiter aus. Sobald man sich die Frage stellt, warum man diese strenge Stufung so benötigt, ist das oft ein Punkt, an dem man sie wahrscheinlich bald weglassen kann.
Inwiefern fügen sich hier instrumental spezifische Techniken in die Methode von Gordon ein? Also als Blechbläser zum Beispiel Stoßübungen oder am Klavier Handhaltungssachen?
Ja, ganz kurz dazu vorher noch: Gordon hat immer gesagt, seine Vorgehensweise ist keine Methode. Das wollte ich nur nochmal kurz sagen. Allerdings sagen das ganz viele, deshalb war es mir nochmal wichtig es zu betonen.
In den Stufen, die Gordon entwickelt hat, geht es um tonale, rhythmische und harmonische Entwicklungen. Das heißt rein technische Fragen sind hier nicht ausgearbeitet. Es gibt Hefte für die verschiedenen Instrumente, die aber eher darauf angelegt sind, Audiation in der Gruppe zu üben. Das heißt aber nicht, dass das nicht möglich ist, sondern es geht einfach darum, wenn ich ein Instrument habe und ich spiele und die Schüler lernen über das Hören so zu arbeiten, dann hören sie bestimmte Dinge auch anders und dann kann ich über das Hören die Technik verändern. Zum Beispiel über Anweisungen: „Das klang jetzt weichfließend. Ich hätte es jetzt aber gerne mal in Portato-Noten. Lass uns das doch jetzt gerade mal probieren, wie das da funktioniert.“
Was ich da total hilfreich finde, das ist aber nochmal ein ganz anderes Fass, was aufgeht, ist von Laban (Anm. d. Red: Rudolf von Laban – Bewegungslehre) verschiedene Bewegungsmöglichkeiten. Da öffnen sich, finde ich, wenn man aus der ganzkörperlichen Bewegung bestimmte Sachen aufs Instrument überträgt, nochmal ganz neue Türen. Also das kann ich nur wärmstens empfehlen.
Das ist jetzt nicht die Antwort auf die Detailtechnik, aber es gibt da verschiedene kleine Türen, die man aber als Lehrer auch selbst durchschreiten muss. Der Ansatz von Gordon ist nicht darauf angelegt ist alles zu erfüllen. Das hat er auch immer ganz klar gesagt.
Outro
Also ich glaube, wir könnten wahrscheinlich noch mal zwei Stunden hier so reden. Und wir haben ja gerade eine neue Tür aufgestoßen. Ich habe auch hier noch ein paar Fragen, zu denen wir gar nicht kamen, aber mit Blick auf die Uhr, würde ich das Schiff – wir sind ja heute hier in Hamburg – in den Hafen fahren lassen. Und ich habe immer, ähnlich wie am Anfang, zwei Fragen, die ich all meinen Gästen zum Abschluss gerne stelle. Was lernen oder üben Sie gerade, was Sie noch nicht so gut können?
Verschiedenes. (lacht)
Geduld. Manchmal denke ich auch, ich kann noch besser und offener und freier in die Zukunft schauen und die Dinge auf mich zukommen lassen kann. Es ist eigentlich alles, was wir tun, jeder Tag, den wir leben, jeder Schritt, den wir gehen, ist ein Neuer. Deshalb war es für mich vorhin auch klar, als Sie nach Lehrer oder Schüler gefragt haben, das mit Schüler zu beantworten.
Und es passieren immer neue Dinge. Und klar, manches hat sich etabliert und ist auch ganz gut so, dass wir nicht auf allen Ebenen alles immer neu erfinden müssen. Aber so dieses Offenbleiben und gucken, was es noch gibt, finde ich super wichtig. Dafür ist es, glaube ich, total wichtig, auf verschiedenen Ebenen bereit zu sein, weiter zu lernen.
Und wenn Sie an Ihre eigene Studienzeit zurückdenken und Ihrem jüngeren Erstsemester Musikstudierenden-Ich, einen Tipp aus heutiger Sicht mitgeben würden, was wäre das für ein Tipp?
Glaube daran, dass das, was du als wichtig empfindest, es auch wirklich ist, auch wenn die anderen das vielleicht anders sehen.
Wer schreibt hier eigentlich..?
Patrick Hinsberger studierte Jazz Trompete bei Matthieu Michel und Bert Joris und schloss sein Studium im Sommer 2020 an der Hochschule der Künste in Bern (Schweiz) ab.
Seit seiner Bachelor-Arbeit beschäftigt er sich intensiv mit dem Thema musikalisches Üben und hostet seit 2021 den Interview-Podcast "Wie übt eigentlich..?"
