In dieser Podcast-Episode spreche ich mit Tabea Zimmermann, einer der bedeutendsten Bratschistinnen der Klassikszene. Wir tauchen tief in Übemethoden, Übeplan-Gestaltung und das bewusste Musizieren ein – und ich erzähle dir, was für mich aus diesem Gespräch besonders herausragt.
Ich lerne: Ein einzelnes Blatt reicht, um einen Baum zu erkennen – und genauso genügt eine charakteristische Idee, um ein Stück unverwechselbar zu machen. Nicht bloß zu spielen, sondern das, was die Partitur sagt, wirklich wahrzunehmen. Mein wichtigstes Werkzeug? Das Ohr – besonders das innere Ohr. Wenn du hörst, was sein könnte, finden deine Finger den Weg dahin.
Statt Quantität zählt Qualität: Es geht nicht darum, stur Zeit abzusitzen, sondern Aufgaben zu bewältigen – musikalisch, technisch, klanglich. Und eines steht über allem: Experimentieren – Tonarten wechseln, Dynamik ausprobieren, Artikulation verändern, Neues wagen.
Wenn du wie ich deinen Übealltag mit mehr Klarheit, Tiefe und Freiheit gestalten willst – nicht nur am Instrument, sondern auch im Kopf – dann lohnt es sich, diese Folge mit Tabea Zimmermann nicht zu verpassen.

Das Interview mit Tabea Zimmermann
Die erste Frage, mit der es immer losgeht, lautet: Vervollständigen Sie folgenden Satz: Üben heißt für Sie?
Experimentieren.
Das finde ich schön. Ich habe in einem anderen Interview von Ihnen gelesen, dass Sie die Energie für die Musik aus dem Leben schöpfen, aber auch andersrum die Energie für das Leben aus der Musik schöpfen. Jetzt ist ja das Leben selten so geradlinig und es gibt immer Höhen und Tiefen. Woher kommt denn die Energie dann für das jeweils andere, wenn einer von diesen beiden versiegt? Einer dieser beiden Quellen.
Also Musik ist wirklich mein Lebenselixier. Ich kann Ihnen sagen, wenn es mir aus irgendeinem Grund mal nicht so gut geht, dann nehme ich meine Bratsche in die Hand oder ich setze mich ans Klavier und lege mir irgendwas hin oder ich spiele einfach drauf los und nach zehn Minuten geht es mir wieder gut.
Also es versiegt quasi nie?
Das kann ich tatsächlich so sagen. Also ich bin einfach sehr froh, dass ich die Freude am Musizieren mir immer erhalten konnte und sie immer wieder neu aufkommt. Ich freue mich einfach an den vielen spezifischen schönen Momenten eines jeden Stückes. Und das versuche ich auch meinen Studierenden weiterzugeben, weil das dazu führt, dass man gerne immer tiefer eintaucht und sich weiter verästelt und noch weiter sucht und schaut und dann wieder Spaß zum Üben hat und dann beim nächsten Konzert wieder probiert und im nächsten Unterricht findet man wieder was Neues und dann geht das einfach so weiter.
Ja, das stelle ich mir sehr schön vor, auf jeden Fall. Apropos Musik. Gibt es denn bei Ihnen aktuell gerade einen Künstler oder eine Künstlerin, den Sie besonders gerne und besonders oft hören?
Oh, jetzt muss ich Ihnen was gestehen. Ich höre ganz wenig Musik. Und zwar höre ich deshalb wenig Musik, weil ich beruflich so viel Musik mache und Musik höre. Also allein durch das Unterrichten, ich bin ja an gut 100 Tagen im Jahr von morgens bis abends mit meinen Studierenden beschäftigt und die Vorbereitung dafür und die Nachbereitung davon und dann die eigenen Konzerte und das eigene Ausprobieren und vom Blatt spielen und so weiter. Das ist schon ziemlich viel. Außerdem gehe ich gerne ins Konzert, aber ich gehe viel lieber ins Konzert, als dass ich mir zu Hause eine CD anmache. Das ist ehrlich gesagt schon ziemlich lange her. Ich würde, wenn ich jetzt einen Wunsch habe, Musik zu hören, dann lieber das Radio anmachen und mich ganz in etwas reinziehen lassen, was ich mir gerade nicht ausgewählt habe. Also je unbekannter, umso besser.
Und auf Ihr eigenes Spiel bezogen, gibt es da einen Musiker oder eine Musikerin, von dem Sie sagen würden, der hat Sie ganz stark geprägt?
Das sind wirklich zu viele, als dass ich da jetzt einen einzelnen rauspicken wollte. Nein, ich suche mir meine Anregungen genauso in der Musik von Kollegen, aber auch außermusikalisch. Also am liebsten aus dem Fenster schauen, einen Baum anschauen und irgendeinen Vergleich zur Natur zu finden. Irgendeine organische Form lässt sich immer mit Musik verbinden.
Übeansatz und Experimentieren
Also experimentieren darf ich ganz viel. Das Experimentieren ist mir wirklich das Wichtigste beim Üben. Ich übe nicht, was ich nachher im Konzert spielen möchte, sondern ich versuche das Material des Werkes, an dem ich gerade arbeite, zu ergründen und nehme das zum Anlass, meine technischen Fähigkeiten zu vervollkommnen. Und dann gehe ich so vor, dass wenn ich irgendwo auf eine Schwierigkeit stoße, dann versuche ich zu verstehen, was daran schwer ist. Ob das jetzt eine musikalische Schwierigkeit ist oder eine technische Schwierigkeit. Und dann nehme ich das aus dem Kontext vom Stück raus und versuche das überall auf dem Instrument: in anderen Tonarten, in anderen Lagen, in anderen Geschwindigkeiten, verschiedener Dynamik. Ich weiß nicht, es wird alles verändert. Bei jedem Durchlauf gibt es andere Parameter. Und daraus ergibt sich dann eine Beweglichkeit, die nicht nur dieser einen Stelle hilft, die ich gerade übe, sondern die sozusagen mein technisch-musikalisches Repertoire erweitert. Und mit diesem Übeansatz macht es einfach Freude. Und dann ist harte Arbeit auch nicht, dass man auf die Uhr guckt und sagt, Mist, jetzt muss ich noch drei Stunden üben. Sondern es ist eher umgekehrt, dass man denkt, oh, ich würde eigentlich gerne noch an der Fragestellung dranbleiben. Aber jetzt ist die Zeit aus, weil ich zum Zug muss oder weil der nächste Student kommt.
Da werden wir gleich noch genauer drauf eingehen, weil da habe ich ein paar Nachfragen, die mir da spontan in den Kopf kommen.
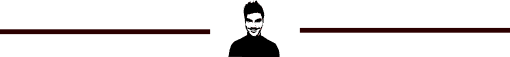

Melde dich für meinen High Five Newsletter an und erhalte 10 Übe-Tipps gratis!
Einmal im Monat nehme ich dich mit hinter die Kulissen meines Podcasts:
- Du erfährst exklusiv, wer meine nächsten Gäste sind.
- Du bekommst praxiserprobte Einblicke in das Thema Üben.
- Du erhältst handverlesene Bücher- und Musiktipps direkt auf dein Handy oder deinen Rechner.
Kurz, kompakt und kostenlos – genau die Inspiration, die du fürs tägliche Üben brauchst.
Nur aktuell: Als Dankeschön erhältst du meine 10 besten Übe-Tipps als kostenloses PDF direkt nach deiner Anmeldung!
Entweder-Oder-Fragen
Um den Zuhörerinnen und Zuhörern Sie als Person näher vorzustellen, habe ich mir zehn Entweder-Oder-Fragen überlegt. Sie haben einen Joker, das heißt bei einer Frage dürfen Sie weiter sagen. Und bei allen anderen bin ich sehr gespannt, wie Sie sich entscheiden werden.
Uraufführung oder Wiederaufnahme?
Uraufführung.
Disziplin oder Spiel?
Spiel.
Frühaufsteher oder Nachteule?
Uhhh, Frühaufsteher.
Sie üben morgens dann auch meistens direkt nach dem Aufstehen?
Nee. Ich übe eigentlich, also dass ich so einen ganzen Tag für mich zum Üben habe, kommt sowieso selten vor. Wenn ich mir Übezeit in den Tag einbauen muss, also ich stehe lieber früh auf, reise irgendwo hin und übe dann. Oder ich stehe früh auf, mache Büroarbeit, gehe dann in die Musikhochschule, mache eine Übepause, unterrichte weiter und bleibe vielleicht abends noch ein bisschen länger. Aber morgens um sieben oder halb acht – das könnte ich auch keinem Nachbarn zumuten. Nee, nee. Da wird erstmal in Ruhe Kaffee getrunken.
Spielen oder Lehren?
Spielen.
Prävention oder Perfektion?
Prävention.
Sofa oder Spaziergang?
Spaziergang.
Ist das auch so die Art von Erholung, wo Sie abschalten können von Ihrem Berufsalltag?
Ja, spazieren gehen finde ich unheimlich cool. Trotzdem mache ich das zu wenig, aber es ist für mich die schönste Art, Gedanken weiterzuentwickeln oder zur Ruhe zu bringen und einfach körperliche Bewegung in der Natur. Also ich bin nicht der Sportstudio-Typ, das liegt mir überhaupt nicht. Ich mache auch leider viel zu wenig Sport, aber spazieren gehen finde ich wirklich wunderbar.
Frage von Jan Donner
Das ist eigentlich ein super schöner Anknüpfungspunkt. Es gibt so eine kleine neue Rubrik im Podcast, wo Gäste, die davor im Podcast zu Gast waren, Fragen an den nächsten Gast stellen dürfen, ohne zu wissen, wer das sein wird. Und Ihr Fragenpate, der eine Frage für Sie vorbereitet hat, Jan Donner, vielleicht kennen Sie den, Professor in Dresden für Posaune, auch ein sehr großer Freund des Spazierengehens, lustigerweise, hat eine Frage mitgegeben.
Und zwar: Wie schaffst du es dauerhaft für Musik zu brennen? Und wie gelingt es dir dabei in Balance zu bleiben?
Also ein bisschen habe ich das ja vorhin schon angerissen, durch das Experimentieren und das Nicht-Festlegen, was im Konzert wirklich zu hören ist. Das ist einfach dieses Im-Moment-Bleiben. Musizieren ist für mich die höchste Form des Fokussiertseins. Ich kann eigentlich bei keiner anderen Tätigkeit so sehr bei mir selber und bei der Sache sein. Und deshalb gibt mir das Kraft, weil das für mich kein Widerspruch ist. Ich nehme die Energie aus dem Material, an dem ich arbeite und versuche, das Schönste zu erleben, was man als Musiker erleben kann: dieser Klang, die Schwingung. Es ist ja nicht nur die Komposition als solches, sondern es ist ein physisches Erlebnis, Schwingung zu erzeugen, reine Obertöne zu spielen, Intonation und Klang. Wenn das funktioniert, wenn man daran gut arbeitet, dann ist das wie eine Therapie. Nur dass ich sie bei der Arbeit mir selber geben kann. Also das hält mich tatsächlich in Balance. Außerdem ist Musizieren für mich immer auch ein Thema der Kommunikation. Ich mache zwar gerne für mich alleine Musik, aber genauso gerne oder noch lieber mit anderen und für andere. Und da kommt immer was zurück. Insofern ist die Anstrengung das eine und die Freude das andere und dann hält sich das die Waage.
Aber das heißt, dieses Feuer für Musik, dieses Brennen für den Beruf, das klingt so, als hätten Sie das durchgehend. Diese Leidenschaft für Musik, wir kennen ja alle Tage, an denen man aus privaten Gründen oder aus welchen Gründen auch immer nicht so gerne in den Überaum geht. Das klingt so, als hätten Sie diese Tage sehr selten, oder?
Ja, ich kenne das wirklich nicht so sehr. Ich hab das in meiner Pubertät vielleicht, da gab es Zeiten, wo ich das Gefühl hatte, ich muss etwas tun, was ich mir nicht ausgesucht hab. Oder als junge Frau, erste Konzerteinladungen, tolle Gelegenheiten, dann tolle Programme ausgedacht und dann merken, oh, ich hab mich verschätzt oder ich kann meine Kräfte nicht gut einteilen. Es ist entweder körperlich zu anstrengend oder die Reiserei ist zu anstrengend oder die Stücke sind zu schwer. Das liegt aber eher in der Vergangenheit. Ich hab das Gefühl, dass ich die Balance am besten gefunden hab durch die Familie, drei Kinder. Das war durchaus sehr herausfordernd, als die klein waren. Es war fast unmenschlich schwer, die Balance zu finden. Aber ich hab dabei auch gelernt, die Zeit, die mir zum Üben bleibt, anders auszufüllen, als ich das davor getan hab. Ich hab meine Übetechniken geändert, ich hab das Üben als Zeit für mich kennengelernt und lieben gelernt. Und jetzt darf ich in Ruhe arbeiten. Vorher war das eher ein Pflichtüben, mit viel mehr Stress verbunden. Inzwischen ist Üben für mich die schönste Zeit, wo ich mit Musik in Ruhe bei mir sein kann.
Das klingt sehr erstrebenswert. Alt oder neu?
Kommt drauf an, worauf Sie das beziehen. Auf ein Instrument bezogen: neu.
Heute oder morgen?
Heute.
Das heißt, wenn man Sie als rastlos beschreibt?
Nö, würde ich nicht sagen. Im Jetzt, im Hier und Jetzt. Ich halte nichts davon, an morgen zu denken, das bringt mir in der heutigen Zeit viel zu viele Sorgen. Dann bin ich lieber im Jetzt und kümmere mich um das, was ich tun kann – in Beziehung mit Menschen, mit jungen Menschen bei der Ausbildung. Da bin ich lieber dabei und finde, Musik ist im Moment das Allerwichtigste, womit wir uns umgeben sollten. Um uns nicht diesem Wahnsinn von Angst und Sorge und Nachrichten auszuliefern. Es gibt eine große Diskrepanz zwischen der Sorge vor dem Morgen, dieser Weltuntergangsstimmung, und dem, was einem wirklich hilft. Da kann man sich nur davor schützen, indem man sich den Bereich der Selbstwirksamkeit definiert: Was ich nicht ändern kann, lasse ich nicht zu nah an mich heran. Und da, wo ich etwas tun kann, da muss ich etwas tun. Das hilft, in Balance zu bleiben. Ansonsten ist das Morgen in der heutigen Zeit kein Hoffnungsbild, eher im Gegenteil. Deshalb bleiben wir lieber im Jetzt und kümmern uns um die direkten Folgen unseres Tuns.
Beruf oder Berufung?
Berufung.
Und als letzte Frage: Routine oder Abwechslung?
Abwechslung.
Das finde ich spannend, Sie kamen ohne Joker durch sogar.
Haben Sie noch ein paar Fragen?
Einblick in den Übealltag
Ja, ich habe noch ein paar Fragen. Wir haben das Üben schon ein paar Mal gestreift, auch Ihren Übealltag. Können Sie uns mal mitnehmen in einen typischen, mehr oder weniger typischen Übealltag von Ihnen?
In meiner heutigen Situation, ich bin jetzt 58, geht es beim Üben hauptsächlich um den Erhalt von Fähigkeiten. Physisch: die Gelenke sind nicht mehr so beweglich. Das Üben eines jungen Menschen ist vielleicht anders als das eines älteren Menschen. Es macht auch einen Unterschied, ob ich gerade ein neues Stück lerne oder Fähigkeiten erhalte. Ich habe beides. Ich muss für Uraufführungen arbeiten, aber der erste Teil des Übens ist einzig der Beweglichkeit und dem Erhalt gewidmet. Ich brauche Geschmeidigkeit, um die Töne mühelos ansteuern zu können. Solange das nicht gegeben ist, übe ich weiter im Aufwärmmodus: Bewegungsabläufe, Tonentwicklungen, Etüden, Fingerübungen, Klangübungen.
Aber solange ich mich nicht fit fühle, kann ich keine schweren Aufgaben lösen. Diese Basis nimmt zunehmend mehr Zeit in Anspruch. Es hängt vom Rhythmus der Konzerte ab: Bei zehn, zwölf Konzerten im Monat bin ich durchgehend fit. Bei weniger Terminen brauche ich länger, um wieder in Schwung und Feinmotorik zu kommen. Das Streichinstrument ist besonders empfindlich. Pianisten können oft bis ins hohe Alter spielen. Bei Streichern ist die Feinmotorik irgendwann nicht mehr so gegeben. Mit 70 denkt man schon öfter: Muss das noch sein? Davor habe ich Angst – diesen Punkt zu verpassen. Aber im Moment wechselt es: Manchmal denke ich, ich höre bald auf. Dann komme ich wieder in Schwung und denke, nein, jetzt spiele ich erst recht, solange es geht.
Realitätscheck im Üben
Das passt ja ganz gut, dass Sie lieber im Jetzt sind als im Morgen. Kann man Ihr Üben so verstehen, dass Sie mit einem wiederkehrenden Block starten – in Resonanz mit dem Instrument, ein Realitätscheck, wie die Feinmotorik am Tag ist? Viele Musikerinnen hier im Podcast berichten davon. Kann man das so beschreiben?
Ja, wobei ich kein festes Programm habe. In der ersten halben Stunde würde ich kaum Noten spielen, sondern eher Akkordprogramme mit Lagenwechseln, Arpeggien. Es muss immer eine Veränderung drin sein. Das Gleiche von gestern zu spielen interessiert mich nicht. Mich interessiert, ob ich sofort eine weitere Option finde: Fingersätze ändern, Geschwindigkeit, Dynamik, Tonart. Alles verändern, damit mehr als nur ein Problem erarbeitet wird.
„Wenn ich nur technisch übe, ohne Schwingung, ist es kein Ton. Ein Ton muss lebendig sein.“
Tabea Zimmermann
Technik und Musikalität sind untrennbar
Sie hatten vorher schon gesagt, dass Sie spielerische Probleme isolieren und variieren – andere Tonarten, andere Rhythmen, andere Fingersätze. Integrieren Sie musikalische Probleme in diesen Grundlagen-Teil? Kombinieren Sie musikalisches und technisches Arbeiten?
Immer kombinieren, ich kann das überhaupt nicht trennen. Ein Ton ist Schwingung. Wenn ich nur technisch übe, ohne Schwingung, ist es kein Ton. Ein Ton muss lebendig sein. Ich übe mit Dynamik, für mich ist alles in der Musik dynamisch. Ich verstehe manchmal nicht, warum Studierende etwas Gleiches machen – alle Sechzehntel gleich, gleich laut, gleich gespielt. Das ist unmusikalisch. Alles, was wir als organisch und lebendig empfinden, ist Veränderung.
Ein Beispiel: eine Bach-Suite mit sechs Sätzen. Ich sage meinen Studierenden: Stellt euch vor, ihr habt sechs verschiedene Bäume. Man braucht ein Blatt, um einen Baum zu bestimmen, und doch hat jeder Baum tausende Blätter, kein Blatt ist gleich. Diese feine Unterscheidung übe ich mit ihnen. Jeder Satz braucht seinen spezifischen Klang – wie eine Eiche oder ein Ahorn. Dafür gibt es eine Toolbox mit spezifischen Klangmitteln pro Satz. Für den nächsten Satz eine neue Toolbox. So wird es variantenreich, jeder Satz hat seinen eigenen Klang.
Differenzierung und Interpretation
Bleiben wir im Bild: Würden Sie sagen, dass jedes Stück einem festen Baum zugewiesen ist, oder ist das offen, abhängig von den Studierenden?
Das ist offen. Eine feste Zuordnung einer Baumsorte würde ich nicht vornehmen. Das Bild soll nur zeigen, wie verschieden Klänge sein können. Und um differenziert musizieren zu können, brauche ich Differenzierungsmöglichkeiten in der Technik. Ich will nicht üben, dass etwas gleich ist. Fünf gleiche Blätter wären kein Baum. Ein Baum darf krumm und verwachsen sein – das macht ihn organisch und lebendig.
Was gehört in die musikalische Toolbox?
Ich finde das Bild sehr schön. Sie haben die Toolbox angesprochen, mit der man erarbeitet, wie sich ein Blatt formt. Was ist in so einer Toolbox bei Ihnen?
Das hängt vom Werk ab. Eine Bach-Suite braucht eine barocke Klangwelt, eine andere Intonation – nicht temperiert, sondern nach Tonart und Charakter. Eine Brahms-Sonate stellt ganz andere Fragen. Das Material gibt die Fragestellungen her. Das Wichtigste: Das Ohr ist das wichtigste Organ des Musikers, nicht die Finger. Was wir hören können, dafür finden wir eine Lösung mit den Fingern. Deshalb stört mich die Vorstellung, Musiküben sei nur Fingerübung. Ich habe nur Lehrer gehabt, die von Anfang an Musik gemacht haben – darüber bin ich froh.
Partitur als Grundlage der Fragestellung
Sie haben das Wort „Fragestellung“ betont. Es geht nicht nur um Finger, sondern darum zu fragen: Was braucht dieses Stück von mir? Was kann ich geben? Das macht einen großen Teil Ihres Übens aus, oder?
Genau. Eigentlich befrage ich die Partitur. Das ist nichts Esoterisches, sondern Textarbeit. Ich spiele ein Thema und frage: Was bist du für ein Thema? Möchtest du so oder so sein? Verschiedene Varianten ausprobieren. Für jede Entscheidung muss es eine Begründung in der Partitur geben.
Wichtig ist auch: Hat der Komponist ein Instrument gespielt? Viele große Komponisten waren Pianisten. Ihre Notation ist vom Klavier gedacht. Streicher interpretieren Punkte und Striche anders als Pianisten. Wenn ich Brahms, Beethoven, Schubert am Klavier denke, komme ich zu anderen Ideen. Es soll natürlich nicht nach Klavier klingen, aber Notation ist immer eine Annäherung. Herauszuarbeiten, was eindeutig ist, ist die Aufgabe. Das ist bei jedem Stück und Komponisten anders. Mit so einer Fragestellung macht das Entdecken Freude. Dann habe ich eine Idee, wie es klingen könnte, und suche die Technik. Wenn ich mit Technik anfange, spiele ich nur das, was ich schon kann.
„Viele große Komponisten waren Pianisten. Ihre Notation ist vom Klavier gedacht. Streicher interpretieren Punkte und Striche anders als Pianisten. Wenn ich Brahms, Beethoven, Schubert am Klavier denke, komme ich zu anderen Ideen.“
Tabea Zimmermann
Sicherheit im Konzert
Ihr Ansatz erinnert mich an das differenzielle Lernen von Wolfgang Schöllhorn. Da geht es um Varianz in Bewegungen. Wenn man immer Unterschiede übt – woher kommt dann Sicherheit? Wie vermitteln Sie Studierenden Sicherheit für den Auftritt?
Sicherheit kommt aus der Vielzahl möglicher Fehlerkorrekturen. Nehmen wir mal einen Streichquartett, das ist eigentlich ein gutes Beispiel, weil alle vier Spieler haben nur eine relative Intonation. Also ich kann nicht genau üben, wo jeder seinen Finger hinbewegt. Ich kann aber üben, das nimmt übrigens wahnsinnig viel Zeit im Streichquartett, wie so ein Akkord im besten Fall klingen soll. Das heißt, man trainiert die Idealvorstellung. Und dann ist es ein immer wieder sich annähern und das Üben ist ein schneller annähern und sich diesem Gesamtklang, also finde ich meine Terz im Akkord oder finde ich meine Quinte im Akkord, setzt voraus, dass ich weiß, dass ich die Terz spiele oder dass ich die Quint spiele. Wenn ich das nicht weiß, kann ich nur ungefähr sauber spielen. Und das dauert halt, um sich das zu erarbeiten.
Mit meinen Studierenden gehe ich exemplarisch vor: Wir arbeiten ein Werk sehr in die Tiefe und lesen daneben andere schnell, vom Blatt. Dabei versuchen wir, gar keine Fehler zu machen, sondern schon im inneren Ohr zu hören, bevor der Finger die Saite berührt. Diese Mischung bringt uns dahin, Musizieren als Voraushören, Spielen und Korrigieren in einem zu erleben.
Langsames Üben
Ich war neulich in Freiburg bei Professor Clemens Wöllner, und er hat eine spannende Studie zum langsamen Üben gemacht. Er hat über 250 Profis und Amateurmusizierende gefragt, wie sie langsames Üben in ihren Übealltag integrieren.
Oh, da habe ich großes Interesse dran, weil es für mich nur Langsam gibt.
Sie üben nur langsam?
Ich übe eigentlich nur langsam. Beziehungsweise – sagen Sie noch, Sie wollten noch etwas erzählen von Ihnen.
Nein, meine Frage wäre gewesen, wie Sie das integrieren. Die Studie ist von vor drei Jahren, also relativ neu. Ich bin sehr neugierig, nachdem ich herausgefunden habe, wie meine Interviewgäste langsames Üben integrieren, und wie sie Werke auf Schnelligkeit üben. Also wie der Übergang passiert zwischen „Ich übe alles sehr langsam“ und „achte“, wie Sie gesagt haben, auf ein fehlerfreies Spiel.
Fehlerfrei klingt nicht gut.
Ja, ich bin offen für ein… Wir haben auch im Interview gesucht. Ich habe gesagt, Fehler vermeiden finde ich nicht schön, das klingt komisch.
Nein, genau. Ich würde das Wort Fehler umgehen. Wir können noch suchen.
„Stellt euch vor, ihr habt sechs verschiedene Bäume. Man braucht ein Blatt, um einen Baum zu bestimmen, und doch hat jeder Baum tausende Blätter, kein Blatt ist gleich. Diese feine Unterscheidung übe ich mit ihnen.“
Tabea Zimmermann
Prinzipien des Langsam Übens
Wie integrieren Sie das langsame Üben?
Für mich ist wichtig, dass ich jedem einzelnen Ton oder jeder einzelnen Einheit Aufmerksamkeit schenke – Buchstabe, Silben, Worte, Sätze. Es kommt auf die Schwierigkeit an, wie schnell man spielen kann. Man sollte nie schneller spielen, als man es gut umsetzen kann. Vielleicht kann man dieses Wort nehmen. Da ist kein Fehler drin, aber es ist auch nicht perfekt. Es ist wie beim ersten Lesen eines Buchs: Manchmal geht man einen Satz zurück.
Heute hören viele junge Leute eine neue Partitur vorher an. Das finde ich schade. Das selbständige Entdecken ist viel wertvoller, weil es das Voraushören trainiert. Ich habe von meinem Bratschenlehrer und meinem Klavierlehrer gelernt, den Finger erst dann aufs Instrument zu setzen, wenn ich weiß, was ich hören werde. Das muss man langsam erarbeiten. Wenn man das kann, kann man fließender spielen. Auch beim ersten Lesen versuche ich musikalischen Fluss, Phrasenlänge, Dynamik, Spannung und Entspannung mitzudenken.
Vom Langsam- zum Schnellspiel: Gruppen bilden und steigern
Und wenn sehr schwere Passagen kommen, die man auf Geschwindigkeit trainieren muss?
Beim langsamen Üben gehe ich in kleine Abschnitte und trainiere kleine Gruppen auf Geschwindigkeit. Gehen und Laufen sind verschieden. Ich muss den Finger anders aufsetzen, den Bogen anders aufsetzen, deshalb sollte ich das nicht zu langsam üben. Wenn ich zu große Notengruppen hintereinander spiele, fange ich an zu pushen. Ich suche mir je nach Rhythmus der Musik Gruppen: Wenn es ein triolisches Stück ist, dann spiele ich viel Triolen und versuche, sie vorauszuhören. Dann einmal schnell spielen, nachhören: War das gut? Mache ich es nochmal. Wenn es gut ist, nochmal – mit weniger Aufwand.
Wichtig ist, in dem Moment, in dem das Klangergebnis gut ist, in den Körper reinzufühlen und zu überlegen: Brauche ich wirklich so viel Kraft, oder schaffe ich das gleiche Ergebnis mit kleinerem Aufwand? Einen größeren Klang mit weniger Aufwand. Wenn man das immer wieder mit einarbeitet, kann man die Gruppen vergrößern. Bleiben wir beim Triolenbeispiel: Dann kommen als Nächstes sieben. Immer mit Richtung und möglichst reflexartig denken, dann einmal spielen und nachhören. Wenn es gut war, nochmal mit weniger Aufwand. Wenn es nicht gut war, eine Stufe langsamer, dann wieder eine schneller und dann mit mehr Dynamik, und so weiter.
„Chunking“
Motorik und Übertragungen aus der Forschung
Das ist spannend. Das ist wahrscheinlich dieses Chunking, das Sie ansprechen. Ich finde es witzig, dass Sie das Beispiel mit Gehen und Laufen gebracht haben. Es gibt von Eckhart Altenmüller ein sehr schönes Video auf YouTube, in dem er das vormacht und neurophysiologisch erklärt: Es sind verschiedene Areale im Gehirn. Man kann nicht unbegrenzt schnell gehen, weil das Programm Gehen irgendwann am Ende ist, und man läuft automatisch. Diesen Gedanken aufs Spielen zu übertragen gefällt mir: das Programm fürs schnelle Spielen früh anlegen, kleine Gruppen am Endtempo üben, und die Gruppen größer werden lassen, wenn es – wie wollten Sie sagen – gut funktioniert.
Ich habe das von meinem ersten Lehrer gelernt. Er kam aus einer Methode eines sehr berühmten Streicherlehrers. Er hat in New York unterrichtet, war gebürtiger Grieche, Demetrius Dounis. Er hat viel zum Thema geschrieben. Er war eigentlich der erste Musikerarzt oder Arzt für Musiker, der auf Beweglichkeit, Schnelligkeit, Geläufigkeit – aber immer im Sinne der Musik – genau diese Gedanken notiert hat.
Specific Technical Exercises
Tabea Zimmermann lernte nach dieser Methode über einen direkten Schüler von Demetrius Dounis. Sehr Techniken sind in diesem Buch überliefert.
Wenn du das Buch über diesen Link kaufst, erhalte ich eine kleine Provision (ca. 10 %) – für dich bleibt der Preis gleich. Du unterstützt damit direkt meine Arbeit. Vielen Dank dafür! 🙂
Spannend, das schaue ich mir an.
Es gibt tolle Übungen für Streicherlehrer. Allerdings braucht man jemanden, der es zeigt. Es geht immer wieder darum: Das Ohr leitet die Hand. Bewegungen sind von einem normalen Körper auszuführen. Es gibt keine geborenen Trompeter oder Bratscher. Wir müssen alles mit dem normalen Öffnen und Schließen der Hand in Verbindung bringen, mit dem Öffnen und Schließen des Arms. Auf dem Streichinstrument bewegen sich Bewegungen durch die Gelenke in Kurven, nicht in geraden Linien. Wenn jemand Lagenwechsel als gerade Linie zeigt, klingt das nicht schön, das tut weh, das wird nicht musikalisch und bleibt hörbar.
Das Integrieren einer musikalisch-technischen Schwierigkeit in einen normalen Körperablauf ist wahnsinnig wichtig, damit man bei großer Anstrengung keinen Schaden nimmt und die Musik dieses atmende Spannen und Entspannen behält. Dann kann man viel spielen, ohne müde zu werden.
Erste Unterrichtserfahrungen als Kind
Es klingt so, als hätten Sie sehr früh sehr guten Unterricht genossen und die richtigen Techniken kennengelernt. Sie haben trotzdem gesagt, dass sich das Üben mit Ihren drei Kindern verändert hat. Wie haben Sie durch Ihre Kinder gelernt, effizienter oder anders zu üben?
Ich möchte betonen: Ich hatte die allerbesten Lehrer in meiner Kindheit. Fantastisch. Das war ein Team von Lehrern an der Musikschule in Laar im Schwarzwald, wo ich aufgewachsen bin. Sie hatten in Detmold studiert, bei einem amerikanischen Cellisten namens George Neikrog. Er war ein direkter Schüler von diesem Demetrius Dounis aus Amerika und hatte in Detmold in den 60er Jahren eine Professur für Streicherpädagogik und Streicherkammermusik, glaube ich.
Das Ziel war: Die kleine Stadt Laar wollte in den 60er Jahren eine Musikschule eröffnen oder vergrößern. Vorher gab es Bläserbands, dann wollten sie Streicher, Kammermusik und ein Orchester. Sie fragten in Detmold bei Herrn Neikrog an, ob er jemanden benennen könne. Er wählte einen aus und fragte: Kannst du dir vorstellen, Musikschulleiter in einer süddeutschen Kleinstadt zu werden? Der suchte sich ein paar Kommilitonen aus. Sie kamen als Team nach Laar und begannen wunderbar – mit der Idee, dass man alles durch Kammermusik und gemeinsames Musizieren trainiert.
Wir hatten ganz kleine Unterrichtseinheiten, aber mehrfach in der Woche, sodass man zu Hause nichts falsch machen konnte. Man ging kurz in die Musikschule. Für meine Mutter hieß das: Wir sind sechs Geschwister, ich bin die vierte – jeden Nachmittag in die Musikschule fahren. Es gab musikalische Früherziehung, dann sagten die Lehrkräfte: Talent ist da, wollt ihr Instrumente? Mein Bruder bekam Klavierunterricht, meine Schwester Cello, die andere Schwester Geige. Ich als Kleinste wollte mitspielen. So fing ich früh an – mit drei Jahren Bratsche spielen ist nicht normal –, aber ich wollte mitmachen und mochte den Geigenlehrer meiner Schwester. Wir fuhren fast täglich. Ich kannte alles. Die Musikschule brauchte kleine Bratscher für Kammermusik. So kam eins zum anderen. Ich saß mit vier Jahren im ersten Streichquartett und spielte „Kunst der Fuge“, dann mit meinen Schwestern im Streichtrio, Kinderorchester, Musikschulorchester.
Es hatte immer den Aspekt: Der Ton steht in Beziehung. Zur Bassnote, zur Melodie, zum Rhythmus. Das von Anfang an mitzukriegen, war das Beste. Es war ein bewegliches, dynamisches Modell des Musizierens, das man anpassen kann. Wenn man etwas Festgelegtes lernt und später sagt ein anderer Lehrer: Das geht ja gar nicht – dann hat der Studierende ein großes Problem, weil man Bewegungs- und Gedankenmuster überschreiben will.
Ich rechne meinen Lehrern hoch an, dass sie am Anfang bewegliche Netze ausgelegt haben, an die man anknüpfen kann. Ich musste nie umlernen. Ich konnte aufsatteln. Niemand sagte mir: Das darfst du ab jetzt nie mehr machen – Vibrato, Bewegung usw. Bewegungsmuster zu ändern ist sehr mühsam.
Pädagogik heute: Neues aufbauen statt überschreiben
Wie gehen Sie heute damit um, wenn Studierende mit eingefahrenen Mustern kommen?
Beim Thema Vibrato zum Beispiel ist es extrem heikel: Wie baut man Neues auf, ohne in Konflikt mit dem Alten zu kommen? Ich möchte jungen Erwachsenen nicht zumuten zu sagen: Das überschreiben wir. Ich versuche Wege zu finden, wie neue Information, eine andere Art heranzugehen, neue Bahnen im Gehirn legt und sich durch viele Wiederholungen durchsetzt. Eine Bewegung zu korrigieren ist wahnsinnig schwer.
Frühe Unterrichtserfahrungen:
Spielen, Hören, Experimentieren
Das klingt so, dass das bei Ihnen schon sehr früh nach Experimentieren im Unterricht war. Wenn Sie sagen, Töne in Beziehung zu setzen, ist das ja nicht das Klassische „Wir legen ein Stück auf und spielen von links oben nach rechts unten“, sondern ein Ausprobieren: Wie verhält sich meine Stimme zu meinen Mitspielerinnen und Mitspielern? Wie kann man das schaffen – Sie haben das Spielen in der Gruppe angesprochen –, wenn man einen Akkord aushält: Wie fühlt es sich an, wenn meine Terz zu hoch oder zu tief ist, also die Quinte nicht sauber intoniert ist? Das klingt, als hätten Sie selbst sehr früh diesen spielerischen Ansatz genossen?
Ja, mit hohem Anspruch. Von Anfang an gab es einen hohen Anspruch an Klangqualität und gleichzeitig ein Hinführen zu besonders schöner Klangqualität, indem es darum geht, Schwingung zu erzeugen und zu erhalten. Das kann man sehr früh mit Kindern machen. Ich möchte an dieser Stelle Streicher unter den Hörern ansprechen, auch Streicherlehrer. Es ist wichtig, dass wir am Anfang mit Kindern, die ein Instrument lernen, das Prinzip „Saite“ als solches akzeptieren und es nicht mit einem Tasteninstrument verwechseln – bitte keine Punkte aufs Griffbrett kleben. Das ist ein ganz anderer Weg im Gehirn. Eine Saite funktioniert über Proportion, die Gesamtlänge der Saite. Es gibt keine gleichbleibenden Abschnitte wie auf einer Taste am Klavier, kein Maß, mit dem ich dem gerecht werden kann. Alles ist mit dem Öffnen und Schließen der Hand verbunden.
„Sicherheit kommt aus der Vielzahl möglicher Fehlerkorrekturen.“
Tabea Zimmermann
Wenn man am Anfang lernt, was eine leere Saite ist und dann das Oktav-Flageolett, hat man Physik und Streichinstrument in einem gelernt – und gleich noch etwas für den Mathematikunterricht. Dieses Lernen von Proportionen und Intervallen und dann immer wieder suchen, wie ich natürlich sauber treffe, aber nicht mit der Idee: „Ich klebe hier einen zweiten oder dritten Finger hin“, denn der Ton stimmt so nie. Das ist ein fauler Kompromiss und gibt Kindern am Anfang eine falsche Sicherheit. Anstatt das Gehör zu trainieren, trainiert man den Finger – wobei man auf dem Streichinstrument keine Sicherheit hat. Wir müssen als Streicher jeden einzelnen Ton wählen, wo wir den Finger hin tun, damit er stimmen kann. Das wäre eine große Bitte an die Streicher: keine Pünktchen aufkleben.
Effizienteres Üben: Familienalltag und Anpassung
Und Sie haben gesagt, dass sich durch Ihre drei Kinder das Üben massiv geändert hat. Wie kann man sich das vorstellen?
Da ging es um effizienteres Üben. Ein Beispiel: Als mein erstgeborener Sohn vier war, hatte ich eine große Uraufführung vor mir – ein Bratschenkonzert von Heinz Holliger, eine wahnsinnig komplexe Partitur – und ich war richtig im Übestress. Mein Sohn wollte Schlagzeug lernen. Er hat sich sämtliche Kochtöpfe in meinem Musikzimmer aufgebaut und während ich mir die Partitur erarbeitet habe, Schlagzeug gespielt. Ich wollte ihn nicht stoppen, ich konnte ihn auch nicht stoppen, ich wollte aber mein Ding machen. Dann habe ich gelernt, diese berühmte Bubble, in der wir uns bewegen, so stark zu hören, dass ich es trotzdem schaffe. Ich habe natürlich länger geübt als er, das war okay. Aber das waren Momente, in denen ich dachte: Ich muss eine Technik finden, wie ich das bei jedem anderen Lärm auch machen kann.
Im Hotel zum Beispiel, wenn ich als reisende Künstlerin unterwegs bin, kann ich nicht mit normalem Klang spielen – ich würde die Nachbarn stören. Da habe ich eine Technik erarbeitet: Ich spiele mit einem Haar – ein richtiger Flitzebogen –, das ist wie Flüstern, Text sprechen mit Flüstern. Das ist extremes Training der linken Hand, und der Bogen berührt mit einem Haar nur die Saite. So hören die Nachbarn nichts, aber ich höre genug, um zu wissen, ob es sauber war oder nicht. Man muss sich an die Gegebenheiten anpassen.
Also auch da wieder viel Experimentieren.
Ja, das hat mich am weitesten durchs Leben getragen und macht mir heute noch Freude.
Tabea Zimmermanns Übung:
Stimmen, Flageoletts und Lagenwechsel
Mich macht sehr neugierig, was Sie als Übung für uns mitgebracht haben, weil Sie schon so viel über Übetechniken und -methoden gesprochen haben.
Dann hole ich meine Bratsche.
Sehr gerne.
Ich fange beim Stimmen an. Nicht mit dem Stimmgerät – oder vielleicht mit der Stimmgabel, nehmen wir eine alte, schöne Stimmgabel, die auf dem Holz schwingt. Dann hole ich mir das A und über die Flageoletts. Gleich beim Stimmen das Gehör trainieren – nicht aufs Stimmgerät schauen, ob es grün, plus oder minus zeigt. Man soll dem Ohr vertrauen.
Ich zeige eine Übung, die man in verschiedenen Varianten machen kann. Das kombiniert vieles, worüber ich gesprochen habe: Klangvarianten, das Griffbrett erarbeiten. Eigentlich eine Lagenwechselübung, aber auch Intervallübung. Ich versuche von einer x-beliebigen Note bis zur Oktave alle Halbtöne unterwegs zu erarbeiten. Ich mache es vor, das ist klarer.
Das kann ich in vielen Möglichkeiten verändern. Was Sie gehört haben, ist eine Kombination aus Crescendo mit Vibratoentwicklung, der Bogen wird im Crescendo intensiver, und die Zielnote wird so angepeilt, dass man im letzten Moment mit einem lockeren, aus dem Gelenk geschüttelten Lagenwechsel ankommt. Ich kann das variieren, indem ich nicht mit einem Finger spiele, sondern mit zwei verschiedenen Fingern. Und hoffentlich hören Sie gar nicht, dass ich zwei Finger benutze
Nachdem ich das eine Weile gesanglich gemacht habe, kann ich es sportlicher und präziser anspielen. Das kann ich in allen Fingerkombinationen, auf allen Saiten, in allen Dynamikstufen machen. Immer wieder das Griffbrett musikalisch-technisch erarbeiten – das ist eine Grundübung. Damit fange ich morgens gerne an.
Perfekt, vielen Dank. Ich saß quasi dabei – obwohl ich die Finger gesehen habe, habe ich nicht gehört, dass es zwei verschiedene Finger waren. Ich habe mich gefragt, ob das eine typische Übung ist, um das Instrument zu spüren und kennenzulernen. Sie haben am Anfang gesagt, dass man schaut, wie sich der Tag auf dem Instrument widerspiegelt. Das ist eine sehr gute Übung, um in Resonanz zu kommen mit dem Instrument.
Auf jeden Fall. Vor allem, weil es bei uns Streichern stark um das Koordinieren sehr verschiedener Aufgaben geht. Es ist extrem komplex: Links und rechts müssen unabhängig voneinander funktionieren und gleichzeitig total synchron sein. Wir brauchen hunderte Zaubertricks, um instrumentale Gegebenheiten zu überspielen. Lagenwechsel, Fingerwechsel, Bogenwechsel und Saitenwechsel – das sind die vier Haupthürden, die man bei jedem Streicher zuerst hört. Wir müssen akzeptieren oder lernen, dass nicht jeder Komponist jeden dieser Wechsel als hörbare Veränderung in einer Melodie hören will. Das heißt, wir müssen das können. In jedem Tempo und in jedem Stück kommt es vielfach vor, dass man eine oder alle vier Hürden überspielen muss. Das geht nur mit gewissen Zaubertricks: eine feine Abstimmung zwischen rechts und links, sodass der Bogen der linken Hand hilft oder die linke Hand dem Bogen hilft, damit man etwas im Klangschatten unauffällig macht und es nicht jeder merkt.
Wiederholung vs. Variation: Routine, Repertoire und Planen
Sie haben am Anfang gesagt, dass Sie ungern Dinge von gestern wiederholen. Trotzdem gibt es Skalen, Etüden und all das – Dinge wiederholen sich. Ich habe in einem Podcast gehört, dass Ihre Mutter früher für Sie Übetagebuch geschrieben hat. Nutzen Sie jetzt, mit Ihren verschiedenen Toolboxen, die verschiedene Ziele verfolgen, noch Übetagebücher? Planen Sie Ihr Üben voraus, um gar nicht in die Gefahr zu laufen, sich zu wiederholen?
Ich möchte ein paar Dinge klarstellen zum „Gestern“ und Wiederholen. Wir hatten das bei der kurzen Fragerunde vorhin – Routine oder Abwechslung. Es ist immer eine Mischung. Als Bratschistin habe ich Repertoire, das ich immer wieder spiele. Diese Stücke kommen in meiner Karriere wieder. Es kann das gleiche Stück sein, aber ich möchte es nicht genau gleich spielen. Ich versuche gar nicht erst, etwas zu wiederholen, sondern akzeptiere, dass jeder Tag, jeder Raum, jedes Publikum eine Situation schafft – und es gibt Tagesformen. Ich versuche, einen Raum zu bespielen, mit der Akustik zu arbeiten. Insofern ändert sich das ohnehin. Diese kleine Veränderung finde ich hilfreich.
Beim Repertoire ist außerdem wichtig, dass jede und jeder herausfindet, wie viele verschiedene Stücke im Jahr gut tun. Man muss unterscheiden: Bin ich fest angestellt in einem Orchester, wo mein Arbeitgeber entscheidet, was auf dem Pult steht? Oder bin ich freischaffend und muss herausfinden, welche Engagements ich annehme, wie viel ich schaffe, wie viel Vorbereitungszeit ich brauche? Das sind zwei sehr verschiedene Settings.
Ich kann von mir erzählen: Für mich ist es eine Lebensaufgabe, die Balance zu finden aus Wiederholung mit Veränderung, neuen Werken und aus jeder Situation etwas mitzunehmen, was mich zu einer besseren Musikerin macht. Ich möchte immer etwas verbessern, verändern. Diese Balance ist mein Hauptthema – seit 35 Jahren. Ich bin nie zufrieden. Entweder sind es zu viele Termine und das Reisen strengt mich furchtbar an – das Spiel nicht. Ein Kollege erinnerte mich gestern daran, dass ich vor zehn Jahren sagte: Wir werden fürs Reisen bezahlt, nicht fürs Konzertieren. Das Konzert macht mir Freude, die Reise dahin ist anstrengend.
Die Balance: wie viele Werke, wie viel Vorbereitungszeit – das ist schwer einzuschätzen. Man muss Entscheidungen für in anderthalb oder zwei Jahren fällen, bei Uraufführungen manchmal für drei Jahre. Woher weiß ich heute, wie ich mich in drei Jahren an einem Mittwoch fühlen werde? Das ist schwer. Aber man lernt, aufs Innere zu hören. Ich arbeite gerne mit meinem Unterbewusstsein als Beobachter meiner Situation. Wenn ich ein größeres Projekt vor mir habe, gibt es eine Phase, in der ich die neuen Noten wochenlang auf- und wieder zuschlage. Irgendwann wache ich auf und meine innere Stimme sagt: Heute musst du – jetzt gibt es kein Ausweichen mehr – mit dieser Arbeit beginnen. Dann weiß ich: Jetzt ist der Moment, in dem die echte Arbeit beginnt. Die Zeit davor ist nicht verschenkt. Da ist ein Annähern. Man könnte nicht einfach das umgehen und direkt einsteigen. Es gibt immer ein „um den heißen Brei herum“ und dann annähern, sich mit der Sprache eines Komponisten vertraut machen. Irgendwann kommt der Punkt: Jetzt geht es in die Arbeit – und dann geht es manchmal plötzlich ganz schnell.
Das klingt, mir fehlt gerade ein besseres Wort, sehr intuitiv – auf eine positive Art. Aber trotzdem haben Sie, wie Sie beschrieben haben, Termindruck. Wenn Sie sagen, Sie haben ein Konzert angenommen, das in sechs Monaten stattfindet, liegen die Noten heute vor Ihnen und dann liegen sie sechs, sieben Wochen auf dem Flügel und werden nur auf- und wieder zugeschlagen. Es ist dieser Spannungsgrad zwischen: Ich gehe intuitiv daran, aber gleichzeitig muss ich mein Üben vorausplanen, weil ich weiß, ich habe Unterrichtstermine, Reisen, und trotzdem muss ich Zeit finden, das neue Stück vorzubereiten. Also: Gibt es – meine Frage zielt darauf ab – planen Sie Ihr Üben vor, oder ist es wirklich so intuitiv und auf das Unterbewusstsein hörend, wie Sie es beschrieben haben?
Das Üben plane ich nicht mehr.
Entschuldigung, ich hatte den zweiten Teil der Frage gar nicht beantwortet.
Kein Problem. Ich finde Übe-Tagebücher großartig für meine jungen Studierenden. Deswegen empfehle ich das zu Beginn des Studiums – erst einmal, um sich selbst besser kennenzulernen. Es geht darum, mitzuschreiben: Was macht man? Ohne viel zu erklären lernen sie sich beobachten, und aus der Beobachtung muss jede und jeder andere Konsequenzen ziehen. Manche üben zu viel, manche zu viel am Stück, und manche bekommen es organisatorisch nicht gut hin. Dafür ist ein Übe-Tagebuch sehr gut.
Übe-Tagebuch: Kindheit, Disziplin und Aufgabenfokus
In meiner Kindheit war das eher so, dass meine Mutter Zeiten aufgeschrieben hat – für jedes Stück. Meine Eltern sind keine Musiker und hatten Vorgaben von den Lehrern: Schaut, dass euer Kind eine Stunde, zwei, später auch drei übt. Wenn ich heute diese Übe-Tagebücher aus meiner frühen Kindheit anschaue, wird mir ein bisschen schwummerig, denn ich finde das nicht sehr kindgerecht. Aber ich habe es, glaube ich, gern gemacht, als ich klein war. Ich habe Bratsche gespielt, Klavier, Trio, Quartett, Wettbewerbe vorbereitet, im Schulorchester und Musikschulorchester gespielt, Landesjugendorchester, dann Bundesjugendorchester, wieder Wettbewerbe – es war wahnsinnig viel zu tun.
Ich kann diszipliniert arbeiten; vielleicht habe ich da etwas von meiner Mutter mitbekommen. Mir geht es aber nicht um das Erfüllen einer Zeit, sondern um die Bewältigung einer Aufgabe. Das heißt, ich muss lernen, welche Aufgaben ich mir zutraue. Da kommt die Intuition aufgrund der Erfahrung dazu. Diese Mischung aus Planung und in sich hineinhören finde ich inzwischen gut. Aber ich arbeite eher zu viel – nicht zu viel am Instrument. Ich übe nicht zu viel. Ich unterrichte viel, reise viel. Und das Üben, denke ich manchmal, könnte ruhig etwas mehr sein. Das würde mir gut tun.
Ich finde das sehr bewundernswert. Es macht großen Spaß, Ihnen zuzuhören. Wir könnten wahrscheinlich noch eine Stunde reden. Mit Blick auf die Uhr möchte ich Ihnen am Ende noch zwei Fragen stellen, die ich all meinen Gästen stelle. Erstens: Was lernen oder üben Sie gerade, was Sie noch nicht so gut können? Das darf gern nicht musikalisch sein.
Urlaub würde ich gern lernen. Ganz unmusikalisch. Ich würde gern phasenweise ganz rausgehen können. Das möchte ich lernen. Und von der Balance haben wir ja gesprochen – das bleibt wahrscheinlich weiterhin mein Thema. Etwas zu finden, was sich dem älter werdenden Körper besser anfühlt. Sich nicht überfordern. Das könnte ich lernen.
Und wenn Sie an Ihr jüngeres Ich im ersten Semester Musikstudium zurückdenken: Um welchen Tipp wären Sie damals froh gewesen? Hätte Ihnen das jemand früher gesagt?
Da habe ich nicht so viel. Ich bin ziemlich unbeschadet durch meine Studienzeit gekommen. Ich war etwas rebellisch, habe mir keine Vorschriften machen lassen. Ich habe das Studium als tolle Zeit erlebt, in der ich die große Welt kennengelernt habe – aus meiner kleinen Stadt raus ins große Freiburg. Nur 50 Kilometer, aber es fühlte sich groß an. Auf meine eigene Studienzeit bezogen habe ich da nicht viel. Ich würde lieber den jungen Leuten heute mit auf den Weg geben, dass sie sich individuell entwickeln dürfen. Sie müssen sich nicht zu sehr an anderen messen. Es geht darum, als Künstlerin oder Künstler das eigene Potenzial zu erkennen und alles dafür zu tun, diesem Potenzial gerecht zu werden. Es geht nicht um den Vergleich, sondern um die Frage: Wer bin ich?
Meistens in der Studienphase kommt man in eine neue Stadt, fängt etwas Neues an, möchte sich engagieren und viel üben. Ich sage meinen Studierenden: Übt meistens weniger, aber dafür besser, damit Augen und Ohr für andere Themen offen bleiben. Für junge Menschen heute ist wichtig, nicht zu vereinzeln. Auf Perfektion im Übezimmer stundenlang allein hinzuarbeiten, ist nicht der richtige Ansatz. Sucht jede Gelegenheit, gemeinsam zu musizieren und in den Austausch zu kommen. Wir sind Menschen, wir wollen Kontakt haben – und wir haben die schönste Arbeit: mit Musik Kontakt zu anderen Menschen herzustellen. Davon kann man nicht zu viel machen.
Das finde ich ein sehr schönes Schlusswort. Ganz herzlichen Dank. Das hat großen Spaß gemacht.
Danke Ihnen.
Wer schreibt hier eigentlich..?
Patrick Hinsberger studierte Jazz Trompete bei Matthieu Michel und Bert Joris und schloss sein Studium im Sommer 2020 an der Hochschule der Künste in Bern (Schweiz) ab.
Seit seiner Bachelor-Arbeit beschäftigt er sich intensiv mit dem Thema musikalisches Üben und hostet seit 2021 den Interview-Podcast "Wie übt eigentlich..?"
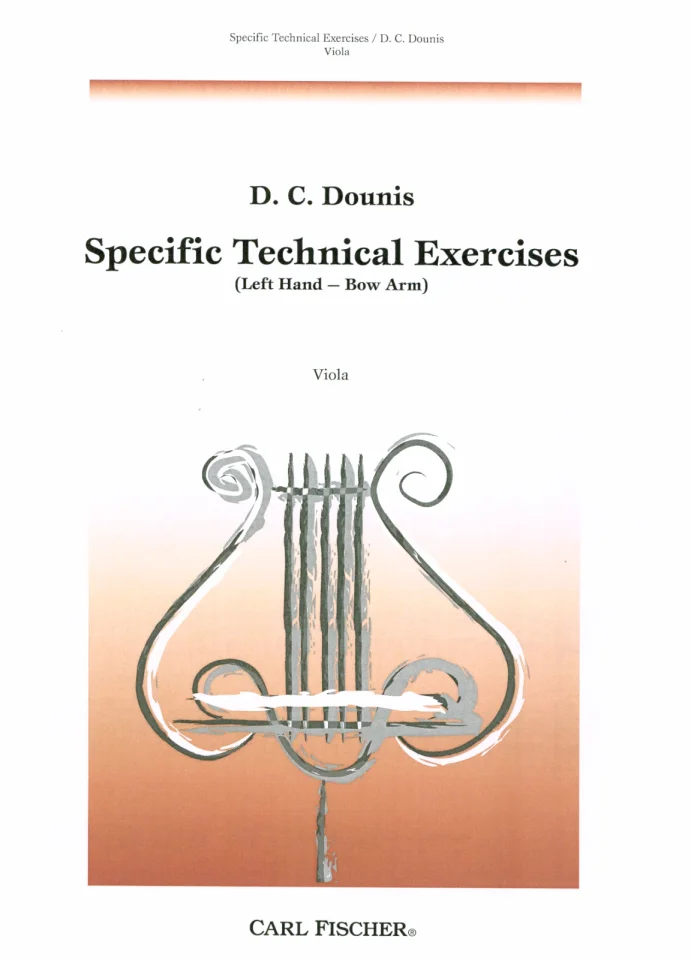

This interview offers fascinating insights into Tabea Zimmermanns musical life, practice routines, and the deep connection she feels with her instrument. Her approach to blending technique with emotion is truly inspiring.