Erlebe, wie Üben wirklich gelingt – mit Harfenistin Antonia Schreiber, Musikerin im Gürzenich-Orchester Köln und ausgebildete Feldenkrais-Pädagogin. Diese Folge zeigt, wie klassische Musiker:innen effektive Übemethoden entwickeln, die weit über Technik hinausgehen – sie verbinden langsames, bewusstes Üben, Körperarbeit und mentales Training, um im Flow-Zustand Klang, Ausdruck und Kontrolle zu verschmelzen.
Antonia erklärt, warum Klang nicht aus Muskelkraft entsteht, sondern aus achtsamen Bewegungen und Schwerkraft. Sie teilt ihre Rituale gegen Lampenfieber, spricht über Improvisation an der Harfe, und warum Musikvermittlung in Kitas, Schulen und sogar Hospizen zu ihr gehört. Lerne, wie Üben zur schöpferischen Praxis wird, wenn Körper und Seele den Takt angeben.


Das Interview mit Antonia Schreiber
Die erste Frage, mit der es immer losgeht, lautet: „Vervollständige folgenden Satz: Üben heißt für dich?“
Mich lernend und forschend und mit Spaß mit meinem Instrument, meiner Person und Musik auseinanderzusetzen. Das finde ich schön.
Gibt es denn bei dir aktuell eine Musik, die in Dauerschleife läuft?
Momentan jetzt nichts, weil ich tatsächlich so beschäftigt war, dass ich fast keine Zeit hatte. Zum Entspannen höre ich aber gerne mexikanische Lieder, weil ich ja auch mexikanische Wurzeln habe. Zum Beispiel Natalia Lafourcade höre ich sehr gerne.
Ist das dann traditionelle mexikanische Folklore?
Ja, vielleicht eher wie Pop aktuell. Pop, aktueller mexikanischer Pop.
Cool, muss ich mal reinhören. Es wird ja auf jeden Fall, das kann man ja schon mal verraten, die „Wie übt eigentlich“-Playlist möchte ich wieder einführen. Also die wird eingeführt. Und die Musikempfehlung von allen Gästen plus quasi die Musik der Gäste soll wieder mehr präsent werden. Das heißt, die kommt auf jeden Fall auf die „Wie übt eigentlich“-Playlist drauf.
Sehr schön. Genau, kann man sich anhören dann.
Und wenn du auf dein Spiel jetzt guckst, würdest du sagen, es gibt einen Künstler oder eine Künstlerin, die dich sehr geprägt hat musikalisch?
Also ich glaube, es gibt schon viele, die mich geprägt haben. Oder auch durch das Hören von vielen wurde ich geprägt. Und auch durch meine Lehrer und Lehrerinnen. Besonders beeindruckt, als ich angefangen habe, haben mich die Aufnahmen mit Isabelle Moretti. Die hat so eine Aufnahme mit französischer Musik für Harfe Solo und eine mit Kammermusik. Und das hat mich damals unglaublich begeistert.
Also ist das so dein Klangideal, kann man das auch so sagen, wo du danach strebst?
Inzwischen vielleicht nicht mehr. Also ich finde ihren Klang immer noch ganz toll. Aber inzwischen strebe ich eher so einen sehr brillanten Klang an und auch etwas Leichtes, aber gleichzeitig etwas wirklich Volles, Rundes, Warmes. Was ich in meinem Orchester auch sehr viel höre und das dann auch gerne in die Harfe reinbringen möchte.

Eindrücke aus der Probe
Ja, das ist ein gutes Stichwort schon. Ich durfte ja heute bei eurer Probe zuhören. Ihr habt Debussy geprobt. Und das ist ja nicht nur irgendeine Probe gewesen, sondern es war auch die letzte, wenn ich es richtig verstanden habe, vor eurem Konzert morgen, oder?
Nee, nee, wir haben noch eine Generalprobe in der Philharmonie.
Ah, okay, es ist nur eine. Das heißt aber, das war eine reguläre Probe. Wenn du jetzt so zurückschaust auf die Probe, was nimmst du heute für dich da mit? Ich habe dich beobachten können. Es gab noch ein paar Einzeichnungen, Rücksprachen mit deinem Akademisten, der neben dir saß. Was ist für dich das, was du nach der Probe für dich mitnimmst, worüber du vielleicht nochmal nachdenkst?
Also die Probe heute hat mir echt total viel Spaß gemacht, weil ich diese Farben, die in dieser Musik kommen, so liebe. Gerade wenn ich bei den anderen höre, die spielen das jetzt so, zum Beispiel die Geigen, bevor der eine Einsatz von uns kommt. Dann stelle ich mir vor, wie unser Klang von den Harfen dazu am besten passt. Dann gibt es auch gar nicht mehr nur leise, laut und voll, sondern ich stelle mir einen Windhauch vor oder etwas Ähnliches, und das versuche ich reinzubringen. Das hat mich total belebt heute. An der Musikalität nochmal Feinschliff zu machen.
Aber es ist ein Stück, das ich schon sehr oft gespielt habe, und dann war ich erstmal fast gelangweilt im ersten Moment. Zum Glück kommt das in meinem Orchester nicht oft vor, dass man etwas so oft spielt. Und dann habe ich aber gedacht, jetzt kann ich neue Sachen ausprobieren, mich austoben und habe echt noch ein paar coole neue Klangfarben und Fingersätze mir ausgedacht. Ich hoffe, dass es so bleibt, dass ich da nicht stehen bleibe.
Neue Experimente mit Klangfarben
Ihr habt „L’après-midi d’un faun“ gespielt. Was sind die Sachen, die du heute in der Probe ganz speziell ausprobiert hast?
Heute in der Probe ganz speziell? Also ich habe eine Sache am Anfang enharmonisch verwechselt. Hast du gesehen, wo ich die Ces und Fes reingeschrieben habe? Das hatte ich offenbar auch mal zwischendrin nicht gemacht. Jetzt habe ich es wieder gemacht und zum Beispiel einmal probiert, mit Ces-H-Ces zu spielen. Das sind drei Oktaven, die nacheinander aufwärts kommen. Und dann habe ich einmal mit H-Ces-H gespielt. Da habe ich gleich meinen Akademisten gefragt: „Was fandest du besser?“ Und er meinte, das, was am Schluss offener klingt. Für uns klingen die Bs immer offener, also das Ces in dem Fall. Also habe ich beschlossen, ich bleibe jetzt mal bei Ces-H-Ces.
Das war, was ich ausprobiert habe. Oder dann habe ich einen Fingersatz ausprobiert, wo man Vorschläge hat. Das habe ich immer rechts, links, rechts abgewechselt. Und jetzt spiele ich einfach mit rechts und links gleichzeitig. Finde ich klingt ganz toll. Wäre ich gerne schon früher draufgekommen. Man hat Sprünge, da muss man gucken, was passiert. Aber eigentlich steht das Tempo. Dann kann man wirklich springen und nicht gucken – wenn man das Stück gut kennt.
Oder die andere Stelle war die, wo die Geigen vorher spielen und dann kommt die Passage mit Holzbläsern zusammen. Ich höre natürlich alles im Mischklang. Dann hat der Dirigent einmal die Streicher alleine spielen lassen. Und ich habe gedacht: Das ist ein inspirierender Klang für mich, da würde ich mich so reinmischen. Obwohl ich im Anschluss spiele, würde ich anschließen. Das hat mein Klangbild nochmal verändert. Ich habe gedacht, ein breiterer Klang, mehr Luft – obwohl ich nicht mit Luft spiele, aber von der Vorstellung her. Leise, aber durchdringend gleichzeitig. Das war mein Bild. Und dann irgendwie klarer. So habe ich, glaube ich, eine Nuance anders gespielt.
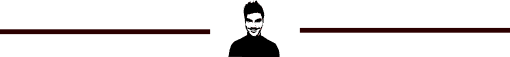

Melde dich für meinen High Five Newsletter an und erhalte 10 Übe-Tipps gratis!
Einmal im Monat nehme ich dich mit hinter die Kulissen meines Podcasts:
- Du erfährst exklusiv, wer meine nächsten Gäste sind.
- Du bekommst praxiserprobte Einblicke in das Thema Üben.
- Du erhältst handverlesene Bücher- und Musiktipps direkt auf dein Handy oder deinen Rechner.
Kurz, kompakt und kostenlos – genau die Inspiration, die du fürs tägliche Üben brauchst.
Nur aktuell: Als Dankeschön erhältst du meine 10 besten Übe-Tipps als kostenloses PDF direkt nach deiner Anmeldung!
Experimente in der Probe
Würdest du sagen, das klingt jetzt für mich, auch neu in der klassischen Welt, nach sehr vielen Experimenten an so einer Probe. Würdest du sagen, das machst du öfter? Also bist du oft so experimentierfreudig für Stücke, wenn ihr die hier probt?
Absolut, ja. Also ich denke, darum geht es eigentlich. Weil wir können das auf alle Fälle alles richtig spielen. Aber unsere Freiheit liegt dann darin, dass wir das gestalten und Musik daraus machen und die Farben machen oder die Richtung oder die Artikulation. Und das ist etwas, das unglaublich belebt, wo man immer weitergehen kann und auch von den anderen lernen.
Jetzt habe ich in der Vorbereitung auch gesehen, ich habe mich mit Debussy beschäftigt, vor allem mit dem Stück, weil ich wissen wollte, worum es da geht. Und das beruht ja auf einem Gedicht von Stéphane Mallarmé, das genauso heißt. Ist so eine Art der Vorbereitung dann auch für dich relevant, wenn du ein neues Stück spielst? Also, wenn die Noten für die neue Spielzeit kommen und du siehst, ah ok, Debussy, das Stück kenne ich gar nicht – recherchierst du dann bewusst, worum es in dem Stück geht? Ob es vielleicht ein Gedicht als Vorlage gibt oder wie andere Orchester es machen? Gehst du da forschend ran?
Also, wenn mir etwas gar nichts sagt, dann auf alle Fälle. Jetzt, dieses Stück ist so berühmt, da muss ich zugeben, da habe ich das Gedicht nicht gelesen, werde ich vielleicht jetzt mal im Anschluss machen. Aber jetzt haben wir zum Beispiel gerade diese Uraufführung von der zeitgenössischen Oper über die Letzten Tage der Menschheit von Karl Kraus gespielt. Da habe ich dann schon recherchiert: Was ist das eigentlich? Weil der Titel ist ja schon erstmal krass und ich wusste überhaupt nicht, wo ich das einordnen sollte. Da habe ich gesehen, das kommt aus dem Ersten Weltkrieg. Also da setze ich mich dann schon auseinander. Aber man muss auch sagen, dass ich sehr viele unterschiedliche Stücke spiele und dass manchmal überhaupt keine Zeit da ist. In diesem Fall habe ich mich eher auf die Klangfarben fokussiert. Aber wenn ich zum Beispiel etwas Solistisches spielen würde, würde ich mich da total damit auseinandersetzen.
Eindrücke aus der Probe
Nimmst du jetzt noch ein To-do mit aus der heutigen Probe?
Vielleicht die Klangfarben ausprobieren. Nächstes Mal beim Einspielen auf demselben Instrument. Jetzt werde ich in der Philharmonie auf einem anderen Instrument spielen, sodass ich dort die Klänge noch genauer herausbekomme, die ich mir vorstelle.
Ja, das hört sich sehr gut an. Also man kann sehr gespannt sein, wie das morgen und am Sonntag klingen wird. Ich habe für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die dich noch nicht so gut kennen, ein paar Entweder-oder-Fragen dabei. Du hast einen Joker. Das heißt, bei einer Frage kannst du skippen. Bei allen anderen Fragen bin ich sehr gespannt, wie du antworten wirst.
Entweder-oder-Fragen
Solo oder Orchester?
Beides.
Das war schon so ausgewählt, dass man gleich den Joker verschiebt. Das macht meine nächste Frage ein bisschen schwierig. Ich hatte nämlich in Klammern „Sieger“ oder „Kammermusik“ aufgeschrieben. Was war das? Also quasi der Sieger von der ersten Antwort gegen die Kammermusik. Aber das ist okay, dann gibt es eine Frage weniger. Harfe oder Klavier?
Harfe.
Uraufführung oder Wiederaufnahme?
Wiederaufnahme.
Das ist witzig. Ich habe gelesen, es gibt ja einen Text über alle Musiker im Gürzenich-Orchester. Und bei deinem steht ganz unten, dass du zu Unrecht zu selten gespielte Werke wiederentdecken möchtest. Was wäre das zum Beispiel?
Zum Beispiel in der Kammermusik: Wir haben mit Flöte und Harfe eine CD aufgenommen. Da haben wir von Marc Bertomieu die drei Pièces für Flöte und Harfe herausgefunden. Ich wusste von diesem Komponisten, dass er sehr schöne Cinq Nuances auch geschrieben hat für Flöte und Harfe. Die waren schon bekannter. Und dann haben wir uns die Noten organisiert und haben das gespielt. Das ist ein tolles Stück, macht wirklich was her, hat sehr schöne Momente. Und das haben wir komplett ausgegraben. Das hat niemand vor uns aufgenommen bis dahin. Das war echt cool.
Wie findet man so einen Schatz dann?
Ich glaube, das liebe ich: zu recherchieren und immer zu gucken zu irgendwelchen Themen. Ich habe viele Listen mit Werken, die mich noch interessieren oder die ich gerne mal spielen würde. Oder einfach offen durchs Leben gehen, nachgucken, dranbleiben. Was ich noch nicht gemacht habe, was ich vielleicht irgendwann mal machen werde, wenn ich viel Zeit habe: was Spezialisten machen, nämlich richtig in Archive gehen und Handschriften anschauen. Dafür hat mir die Zeit bisher gefehlt. Aber über IMSLP oder auch Verlage – das Stück war sogar verlegt, aber es gab keine Aufnahme davon. Und das haben wir eben entdeckt.
Orchesterpraxis
Zählen oder den Einsatz des Dirigenten abwarten?
Zählen.
Kein Verlass. Wir hatten es ja vorher schon im Vorgespräch. Das heißt, du sitzt da wirklich und zählst. Du hast mir vorher eine Finger-Methode vorgemacht, dass du an den Fingern die vollen Takte abzählst. Auch bei so 200 Takten Pause, wie du gesagt hast.
Nein, das braucht man nicht. Da würde ich dann bei den anderen vorsichtig mitlesen. Obwohl, ich habe vielleicht auch schon mal 200 Takte gezählt, weil ich sehr konzentriert war. Das geht mit der Methode, dass man einfach immer einen Finger pro Takt abzählt. Rechts, links, rechts, links – und dann vergehen schon mal 200.
Also quasi einen links und dann den zweiten rechts?
Nein, also fünf. Also eins, zwei, drei, vier, fünf.
Ja, so zähle ich auch. Und dann sechs, die machen dann hinten.
Ja, genau.
Ja, das mache ich auch so. Also es ist eine gute Methode. Wahrscheinlich machen das viele so. Kein Geheimtipp. Vielleicht sogar, wenn zum Beispiel vier Viertel ist, dann wenn man ganz genau gehen will, dann so eins, eins, eins, eins, zwei, zwei, zwei, zwei. Für alle, die es nicht sehen können: Wir sind ja kein Videopodcast. Antonia hat den Finger ein-, zwei-, dreimal aufgetippt, bevor sie zum nächsten Finger übergegangen ist.
Persönliche Routinen
Frühaufsteher oder Morgenmuffel?
Frühaufsteher, aber auch spät ins Bett gehen.
Und wann übst du am liebsten? Morgens oder abends?
Also ich übe eigentlich zu beiden Zeiten gern, aber am besten übe ich, wenn ich morgens auch geübt habe. Wenn ich morgens schon mal was gemacht habe, übe ich den ganzen Tag besser.
Yogamatte oder Meditationskissen?
Yogamatte.
Ist das eine gute Routine für dich zum Abschalten? Yoga?
Also ich finde auch liegen und Bodyscan machen und den Kontakt mit dem Boden sehr wertvoll.
Ja, wir kommen später wahrscheinlich nochmal drauf, wenn wir über Feldenkrais und ähnliche Körpermethoden reden. Abwechslung oder Routine?
Abwechslung.
Heute oder Morgen?
Heute.
Würdest du dich als rastlos bezeichnen?
Nee, eigentlich nicht, weil ich glaube, ich in dem Moment, also eben jetzt auch, schön mich entspannen kann, oft. Also nicht immer, weil manchmal ist es einfach zu viel.
Der gute Übe-Tag
Jetzt haben wir gerade schon dein Üben gestreift und du hast gesagt, das fand ich sehr schön, dass dein Tag besser ist, wenn du morgens schon was gemacht hast. Das ist ja nur ein Bestandteil, aber was würdest du sagen: Wenn du abends, nach dem Zähneputzen, auf deinen Tag zurückblickst und dein Üben betrachtest – wann würdest du sagen, das war ein guter Tag zum Üben gewesen? Was muss daran vorgefallen sein, damit du das sagen kannst?
Also entweder, dass ich für mich selber gut geübt habe – ich liebe einfach dieses Im-Flow-Sein im Üben. Alles vergessen, mir die Klänge vorstellen und das Körpergefühl dabei. Wenn ich das hatte und mit meinen Zielen weitergekommen bin, wenn ich mir gute, klare Ziele gesetzt habe, dann ist es ein guter Tag. Oder auch, wenn ich eine gute Orchester- oder Kammermusikprobe hatte. Selbst wenn ich irgendwo zugehört habe und ergriffen wurde, auch im Konzert, dann kann das schon ein guter Tag sein.
Methoden für den Flow
Hast du Methoden dafür, in den Flow zu kommen?
Manchmal denke ich: Oh Gott, wie soll ich das schaffen? Das muss ich bis heute Abend oder morgen früh können und ich bin spät dran. Oder manchmal habe ich keine Lust, weil ich das Stück erstmal nicht interessant finde. Und dann habe ich gemerkt: Wenn ich anfange und Schritt für Schritt langsam loslege, komme ich automatisch in den Flow. Dann bin ich drin und vergesse alles. Das liebe ich.
Und machst du dir einen Plan dafür? Wenn du sagst, dass du deine Ziele erfüllst, bist du jemand, der sich morgens hinsetzt und sagt: „Das, das und das sollte heute erledigt werden“ – also machst du wirklich Pläne für dein Üben?
Ich habe schon einen Plan, auf alle Fälle. Wenn ich viel Repertoire habe, schreibe ich es mir auf. Wenn ich, wie jetzt diese Woche, nur drei Stücke habe kurz vor der Sommerpause, dann nicht. Aber zeitweise hatte ich so viel, dass ich mir ein Schema erarbeitet habe. Ich nehme ein Blatt in meinem Journal, schreibe links die Stücke untereinander – Solo, Orchester, Kammermusik. Oben schreibe ich die Tage, die ich dafür habe. So habe ich den Überblick, wie viele Tage ich habe. Links stehen die Stücke, rechts oben schreibe ich „genug“. Dann kann ich Kreuzchen machen oder Notizen, was ich gearbeitet habe. So sehe ich, dass ich nichts vergesse, und ich weiß, wo ich stehe. Ich habe gemerkt, dass ich selten bei „genug“ angekommen bin, weil es immer besser geht. Aber es war sehr hilfreich.
Manchmal ist es ja auch gut, den Weg als Ziel zu begreifen und gar nicht bei „genug“ anzukommen, sondern zu merken, man ist anders fokussiert, wenn man sich den Weg freigeschaffen hat, oder?
Ja, total. Ich wäre gern überall bei „genug“ gewesen, aber vielleicht wäre es auch langweilig. Im Moment selbst kann man immer noch mehr geben. Und es muss nicht perfekt vorbereitet sein – im Konzertmoment geht immer noch mehr.
Tägliche Routinen und Grundlagen
Wenn du jetzt nochmal auf dein Üben zurückschaust, würdest du sagen, es hat Bestandteile, die jeden Tag in deiner Routine abgedeckt sind? Oder stellst du dir jeden Tag ein neues Programm zusammen?
Je nachdem, wie viel Zeit ich habe. Wenn ich super wenig Zeit habe, ist immer Bestandteil: hinsetzen, Sitzhaltung checken, wie ist meine Körperhaltung mit der Harfe. Das ist das Allermindeste, weil die Harfe asymmetrisch ist. Man darf seine Symmetrie nicht verlieren. Wenn ich mehr Zeit habe, mache ich eine Einspielübung mit rotierender Aufmerksamkeit auf Klang und Körperempfinden. Dann spiele ich ein paar Akkorde, weil Akkorde wichtig sind auf der Harfe, und überprüfe den Kontakt zur Saite und das Loslassen der Finger. Danach übe ich schwere Stellen aus dem Programm und gehe das Repertoire durch.
Kann man dann sagen, dass du Grundlagentraining auf der Harfe von musikalischer Stellenarbeit trennst?
Nicht direkt. Wenn ich etwas technisch Anspruchsvolles habe, übe ich das sofort nach dem Einspielen, getrennt vom Stück.
Du würdest aber nicht umfunktionieren, wenn du zum Beispiel Arpeggien hast – also herausfordernde Stellen – und sie in dein Warm-Up integrieren?
Doch, das mache ich. Aber ich übe sie nicht so, wie sie am Schluss sein müssen, sondern halte es im Bereich des Einfachen. Ich denke mir Übungen aus, zum Beispiel Rhythmus verändern.
Also so wie punktiert üben?
Nicht punktiert, sondern immer zwei Noten ganz schnell und dann die nächsten zwei. Immer mit Bewusstsein. Bei der Harfe ist es besonders: In dem Moment, wo wir loslassen, kommt der Ton. Wir müssen alles vorher vorbereitet haben und sofort den nächsten vorbereiten.
Okay, aber das ist wie Chunking – also Gruppen bilden, die du schnell spielst?
Genau. Wenn wir Arpeggien über die ganze Harfe haben, setzen wir vier Finger links und vier rechts ein. Dann spiele ich vier-drei ganz schnell, überlege mir, wie zwei-eins am besten klingen, und dann spiele ich die. Im Idealfall ist es sofort perfekt. Wenn nicht, wiederhole ich es. Aber ich habe es schon vorbereitet.
Na krass. Und dann übst du es gar nicht mehr. Wenn es perfekt war, ist es okay.
Ja.
Spannend. Ja, es geht auch immer besser von Tag zu Tag, da habe ich Vertrauen.
Das glaube ich, dass man von Tag zu Tag mehr Vertrauen entwickelt.
Aber übst du immer schon so auf diese Weise?
Nee, ich habe schon im Studium viele Etüden gespielt. Wirklich viele. Also eigentlich sogar ab vielleicht, wo ich zwei, drei Jahre gespielt habe, habe ich angefangen. Etüden, Etüden, Etüden. Es gibt wirklich viele. Jetzt hätte ich die Zeit nicht mehr, weil ich ständig neue Noten lerne. Jetzt muss ich das in die Musik integrieren. Aber als Schülerin und Studentin habe ich sehr viele Etüden gespielt. Und auch Übungen noch mehr gemacht als jetzt.
Ich war neulich in Freiburg bei Professor Clemens Wöllner. Der hat eine Studie zum langsamen Üben gemacht und mit Profis wie auch Hobbymusikerinnen und -musikern gesprochen, wie sie langsames Üben in ihren Alltag integrieren. Ich fand die Studie bemerkenswert und habe mit ihm noch darüber gesprochen. Seitdem bin ich neugierig, wie meine Gäste langsam üben. Wenn du sagst, du übst eigentlich Sachen sehr schnell und mit dem Ziel der Perfektion oder Fehlerfreiheit – wie sieht das bei Läufen aus?
Das ist das Spezielle bei den Läufen. Das funktioniert unglaublich gut. Selbst wenn man es wenig trainiert, klingt der Lauf danach viel brillanter. Das ist wie Zauberei.
Langsames Üben und Körperbewusstsein
Und wie integrierst du langsames Üben in deinem Alltag?
Das liebe ich auch. Langsam üben, wenn ich auf den Klang achte und auf das Gewicht in meinen Armen und im ganzen Körper. Dass das so durch mich hindurchgeht. Dann nehme ich sehr bewusst wahr, woher die Kraft kommt – vielleicht vom Boden und vom Stuhl, auf dem ich sitze. Im Idealfall kann ich beim langsamen Spielen richtig wahrnehmen, dass es durch mich durchgeht. Nicht durch Muskelkraft, sondern in einer Linie, die durch mich hindurchführt.
Das heißt, dein Fokus ändert sich beim langsamen Spielen weg von technischen Aspekten hin zu Klang und Körperwahrnehmung?
Ja, das ist sehr wichtig für mich.
Das hat auch etwas von einem Flow-Zustand, oder?
Absolut, ja. Auch eine Art von Flow.
Das ist spannend, denn das kam auch in der Studie heraus: Viele beschreiben, dass sie beim langsamen Üben in einen Flow-Zustand kommen, weil sie sich bewusst auf eine Sache konzentrieren können, wie den Klang, und den Rest vergessen.
Ja, ich denke auch. Wenn man diese Wirksamkeit spürt, dass man etwas ändern oder gestalten kann, dann gibt das Flow.
Also du erzeugst den Klang bewusst?
Genau, oder verändere ihn.
Ja, das ist spannend. Musik bekommt dadurch etwas Grundsätzliches. Fast transzendent.
Ja, auf jeden Fall.
Zwischen Makro und Mikro
Ich fand das in der Probe spannend, dieses Wechselspiel zwischen Makro- und Mikroebene – rauszoomen, reinzoomen in einzelne Stellen. Du hast es angesprochen, als die Streicher eine Stelle alleine gespielt haben und du das für deinen Einsatz nutzen konntest. Wenn man das aufs Üben überträgt: Wie schaffst du es, wenn du konkret in Lupenarbeit bist, das große Ganze nicht zu verlieren? Und wenn du am großen Ganzen arbeitest, trotzdem den Blick fürs Detail zu behalten?
Sehr gute Frage. Dankeschön. Ich denke, das Wichtigste ist, im Jetzt präsent zu sein. Das hilft sehr. Und ich glaube, es ist dieser Wechsel zwischen beidem. Auch in meinem Leben bin ich fokussiert auf den Moment und gleichzeitig auf die langfristige Entwicklung. In der Musik ist es genauso. Beides ist wichtig.
Nutzt du auch Tools? Nimmst du dich beim Üben auf, um diese Perspektiven wechseln zu können?
Wenn ich Soli habe oder Solo spiele, nehme ich mich auf alle Fälle viel auf. Das hilft mir sehr. Das war in meinem Studium gerade am Kommen. Heute nehmen sich alle viel auf. Es ist unglaublich hilfreich.
Was findest du sonst hilfreich?
Eine wirklich gut eingerichtete Stimme. Das ist für uns Harfenisten total wichtig. Zum Beispiel bei einem Stück von Lachenmann: Wenn ich eine gut eingerichtete Stimme habe, mit ergonomischen Pedalstellen und klaren Rhythmen, ist das die halbe Miete. Das ersetzt viel Üben im Orchester. Und ich kann mich im Ernstfall auf die Stimme verlassen, mich auf Musik und andere konzentrieren und mehr Freiheit haben. Ich schreibe mir direkt nach dem Spielen auf, wie die Pedale bei der nächsten Stelle stehen. Nicht erst später, sondern sofort, damit ich mich wieder in die Musik verlieren kann.
Das ist also Detailarbeit und danach wieder der Blick aufs große Ganze?
Ja, genau. Das ist auch schon fast mentales Üben. Wenn man Stimmen so einrichtet, kann man sich in die Musik einlassen und antizipieren, wie es klingen wird. Klangvorstellung ist entscheidend – auch Rhythmus-, Timing- und Artikulationsvorstellung. Das entwickelt sich über die Jahre. Wenn ich Solo spiele, merke ich: Ich habe ein anderes Timing und Verständnis für die Stimmen meiner Finger. Ich stelle mir vor, ich habe vier Streicher – mein eigenes Orchester. Musik ist wie eine Sprache, die man immer weiter lernt. Mir hilft das innere Bild von der Musik sehr.
Uraufführungen und Klangvorstellung
Wie machst du es, wenn du Uraufführungen hast, bei denen es keine Vorlagen gibt?
Das ist ganz anders. Aber mit dem Spielen und Üben kommt die Klangvorstellung automatisch. Da wächst man hinein.
Das war wirklich sehr wertvoll für mich, dass ich die Möglichkeit hatte und die Zeit, diese Ausbildung zu machen. Und zwar war das so, dass in dieser Ausbildung man sehr viel selber angeleitet wurde zu forschen und wahrzunehmen. Und jetzt, wenn ich zum Beispiel unterrichte, egal ob Feldenkrais oder Harfe, dann versuche ich oft in offenen Situationen, also wo es nicht unmittelbar um eine Probespielvorbereitung geht, sondern wenn man Raum und Zeit hat, dieses Bewusstsein auch den Student*innen zu helfen zu empfinden oder zu erweitern.
Weil oft ist es so, dass wir denken: besser, schlechter, gut oder schlecht. Wir sind sehr schnell in der Bewertung. Aber wenn wir nicht sofort bewerten, sondern erst einmal nur wahrnehmen, merken wir, dass es nicht nur gute oder schlechte Arten zu spielen gibt, sondern Millionen Arten von Ausdruck. Ein Klang, den man hier als schlecht bezeichnen würde, kann in einem anderen Zusammenhang passend sein. Es geht darum, unser Repertoire an Klang- und Ausdrucksmöglichkeiten zu erweitern. Wenn man das Bewusstsein hat und nicht wertet, sondern sieht, wie Körper und Geist zusammen Musik machen, ist das unglaublich hilfreich.
Feldenkrais in der Praxis
Wie kann man sich das konkret vorstellen?
Die Feldenkraisübungen sind so, dass man Bewegungen in der Gruppe macht. Die Anleitung ist verbal: „Du sitzt auf dem Stuhl und bewegst den Kopf auf und ab.“ Jeder macht es anders, niemand versteht darunter dasselbe. Wir sind alle unterschiedliche Menschen. Dann sieht man: Der bewegt den Rücken mit, der bewegt gar nichts mit. Man kann vergleichen, voneinander nachmachen und dadurch sein Repertoire erweitern. Blockaden können sich lösen, weil man Bereiche entdeckt, die man nie bewegt hat. Man erlaubt sich, neue Bewegungen zu machen und wird dadurch insgesamt freier. So habe ich es erlebt.
Forschen beim Üben
Ich stelle mir beim Üben auch vor, dass dieses Forschen wichtig ist – unabhängig vom Körpergefühl. Zum Beispiel, wenn man eine Stelle in einem anderen Genre ausprobiert, etwa ein Jazzstück als Polka. Nicht fürs Konzert, aber um zu sehen, wie es sich anfühlt. Arbeitest du beim Üben auch so bewusst?
Das ist lustig, dass du die Polka erwähnst. Ich habe gerade eine App, die unterschiedliche Stile vorgibt, etwa Drumset, und dann spiele ich dazu statt mit Metronom.
Ist das die Drum Genius App?
Nee, die musst du mir noch sagen. Meine App kam mit einer Improvisationsschule, heißt irgendwas mit Practice. Ich habe sie geholt, um zum Spaß zu üben. Da kann man Stile auswählen und dazu spielen. Das finde ich cool, weil ein anderer Genuss entsteht. In der Klassik geht es oft um Perfektion und Körperbewusstsein. Das ist wichtig, aber der Genuss am Spielen ist genauso wichtig. Einfach genießen.
Atmosphäre im Orchester
Das hat man auch in der Probe gemerkt: eine wertschätzende Atmosphäre, viel Musik, wenig Dienst.
Absolut. Manchmal, bei Opern, die wir oft gespielt haben, fühlt es sich nach Dienst an. Aber meistens nicht. Toll ist, dass alle begeistert von Musik sind. Das ist ein wunderbares Umfeld.
Eine typische Übung
Ich bin sehr neugierig auf die Übung, die du mitgebracht hast.
Das ist eine Übung, die ich gerne am Anfang spiele. Nur mit drei Fingern, nicht mit vier, weil es ergonomischer ist. Ich achte auf meinen Sitz, Fußkontakt, Kontakt von Schulter und Brust zur Harfe und meinen Atem. Dann setze ich mit der rechten Hand drei Finger ein, spüre den Kontakt zur Saite, dehne sie an.
[Musik]
Währenddessen gehe ich meinen Körper durch: Kann ich mehr Gewicht auf die Sitzhöcker abgeben? Kann ich im Bauch loslassen? Ist mein Arm schwer genug? Gibt es unnötige Spannung? Manchmal zittert ein Finger, dann lasse ich bewusst los. Dann zittert er nicht mehr.
[Musik]
Ich achte auch auf Rücken, Nacken, Kiefer, Augen. Danach mache ich das Gleiche mit links. Manchmal bewege ich das Becken nach vorne und hinten oder male mit den Sitzhöckern eine Linie. Oder ich mache Achterbewegungen mit dem Becken. Dabei überprüfe ich immer wieder den Kontakt der Finger zu den Saiten und gehe mit der Aufmerksamkeit durch den Körper. Dann bin ich fast bereit.
Meditativer Klang
Vielen Dank. Ich habe beim Zuhören gespürt, dass ein meditativer Zustand entsteht. Man kann sich im Klang verlieren. Vielleicht, weil die Harfe am Körper anliegt.
Das ist interessant, dass du das so wahrgenommen hast. Meine Feldenkrais-Lehrerin Mia Segal hat gesagt, ich solle mir vorstellen, dass der Klang durch mich hindurchgeht. Genau das habe ich über die Jahre entwickelt.
Also ist diese Übung ein typisches Warm-up?
Für mich, ja.
Kann man sich das als Realitätscheck vorstellen? Wie ist mein Körper heute eingestellt? Wie springen die Finger an?
Ja. Das Gute ist, dass ich dabei viel loslassen kann. Es ist wie ein Spiegel. Ich weiß, wo die Referenz ist. Durch das Scannen finde ich Stellen, wo ich loslassen kann. So komme ich in meine Mitte. Oft muss ich im Moment etwas gut bringen. Wenn ich in meiner Mitte bin, funktioniert es besser.
Lampenfieber und Rituale
Überträgst du den Gedanken auch ins Orchester – wo kann ich loslassen, wo Spannung abbauen?
Nee, es geht nicht nur ums Loslassen, sondern um den richtigen Tonus. Nicht zu entspannt, nicht zu angespannt. Die Mitte finden.
Wie ist es mit Lampenfieber? Bist du im Orchester aufgeregt?
Doch, ich habe Lampenfieber. Aber das hilft mir, über mich hinauszugehen. Mit der Übung habe ich eine gute Referenz zu mir. Dann gebe ich Kontrolle ab und gehe ins Vertrauen.
Hast du ein Ritual vor dem Auftritt, um in diesem Zustand zu sein?
Ja, Ausatmen ist wichtig. Im Sitzen kann ich den Kontakt zum Stuhl spüren, kleine Mikrobewegungen machen. Ich habe auch eine schöne Atemübung gelernt: drei Atemzüge. Der erste: Körperbewusstsein. Der zweite: „Mir kann nichts passieren, ich habe meine Anker.“ Der dritte: an die Musik denken, die ich gleich spiele. Das habe ich in Probespielzeiten geübt. Heute ist es eher ein Moment von Verbundenheit: Ich mache nichts Böses, sondern etwas Schönes. Ich gebe etwas – und gebe gleichzeitig Kontrolle ab.
Körperbewusstsein und Feldenkrais
Du hast mehrfach betont, wie wichtig für dich der Bezug zum Körper ist – das Spüren des Instruments, die Verbundenheit mit Boden und Stuhl. Du hast auch eine Ausbildung als Feldenkreis-Trainerin. Wie nutzt du diese Erfahrungen im Üben und Unterrichten?
Übung und Klangbewusstsein
Jetzt habe ich gelernt, die Harfe ist diatonisch gestimmt. Machst du das immer in der gleichen Tonart oder variierst du, damit du alle Klänge der Harfe nach und nach ausprobierst?
Das wäre vielleicht eine Idee, die ich mal erforschen werde. Bisher war ich ehrlich gesagt zu faul, etwas zu treten. Es ging mir nicht um die Tonhöhe, sondern um den Kontakt zur Saite, mein Körperempfinden und wie der Klang in Verbundenheit mit meinem Empfinden herauskommt. Es geht darum, dass es nicht schrill klingt, sondern voll und rund. Das erreicht man nicht durch Muskelkraft, sondern durch die Schwerkraft. Wichtig ist, dass es durch den Körper durchgeht – dann entsteht der Klang automatisch. Das strebe ich an.
Das heißt, wenn du die Übung zu Hause machst, machst du sie auch langsamer als hier beim Vormachen, damit du nachspüren kannst, wie es sich anfühlt?
Vielleicht nicht viel langsamer, je nachdem, wie viel Zeit ich habe. Aber immer mit starkem Augenmerk auf den Klang.
Vielen Dank fürs Teilen. Eine sehr interessante Übung, die ich selbst einmal ausprobieren möchte. Vielleicht ein kleiner Spoiler: Dein Nachfolger im Podcast ist Tabea Zimmermann. Sie sagte in ihrer Übung etwas Ähnliches: Wenn sie eine Stelle geschafft hat, hängt sie noch einen Durchgang an, in dem sie bewusst loslässt und fragt, ob es noch leichter geht. Das ist ein schöner Gedanke, den man auf jedes Instrument anwenden kann: im Ton aufzugehen, sich zu fragen, wie viel Kraft und Anspannung nutze ich, und wie verändert sich der Ton, wenn ich etwas am Körper verändere.
Ganz genau, das ist es. Und vielleicht auch noch etwas zum Lampenfieber: Wenn ich mir vorstelle, wie alles funktioniert, wie ich danach zufrieden bin, hilft mir das sehr. Nicht „hier muss ich aufpassen“, sondern mir vorzustellen, wie schön es wird. Das hilft mir total.
Lernen und Improvisieren
Antonia, wir könnten noch Stunden weiterreden. Es macht großen Spaß, dir zuzuhören. Aber wir müssen langsam zum Ende kommen. Ich habe zwei Fragen, die ich allen Gästen stelle: Was lernst oder übst du gerade, was du noch nicht so gut kannst? Das darf auch nicht-musikalisch sein.
Viel. Vielleicht könnte man sagen, ich lerne improvisieren an der Harfe.
Mit der App, die du vorher erwähnt hast?
Ja, unter anderem. Aber ich möchte es ausweiten. Es macht total Spaß.
Und wenn du an dein jüngeres Erstsemester-Ich denkst, oder an Masterclasses: Welchen Tipp hättest du dir früher gewünscht?
Dass ich Vertrauen in meinen eigenen Weg haben kann. Dass ich mich nicht unter Druck setzen muss, sondern Vertrauen in meine Musik, meine Musikalität, mein Empfinden und in das, was aus mir herauskommt.
Das ist ein schönes Schlusswort. Antonia, ganz herzlichen Dank. Es hat sehr großen Spaß gemacht.
Ebenso. Richtig viel Spaß. Danke.
Fragen an andere Gäste
Ganz neu ist, dass meine Gäste Fragen an andere Gäste stellen dürfen. Antonia, welche Frage hast du für meinen nächsten Gast?
Gab es irgendwann in deinem Überleben mal eine Zeit, in der das Üben weniger Spaß gemacht hat? Und wie bist du darüber hinweggekommen, was hast du daraus mitgenommen?
Vielen Dank. Ich habe von meinem vorherigen Gast auch eine Frage an dich: Kannst du uns ein Bildungsprojekt aus dem Jugendbereich ans Herz legen und warum?
Da kann ich die Konzerte für Kinder und Jugendliche sehr empfehlen. Sie sind unglaublich wertvoll. Zum Beispiel haben wir im Orchester im Rahmen von „Ohren auf“ – unserem Musikvermittlungsprojekt – Konzerte in Kindergärten und Schulen. Ich habe während Corona ein Projekt entwickelt: Mit Harfe, einem Sänger und einer Schauspielerin waren wir in über 30 Kitas. Besonders dort, wo Kinder sonst wenig Zugang haben, war es schön zu sehen, wie begeistert sie waren. Wenn Eltern später sagen: „Mein Kind hat die Harfe in der Kita gehört und schwärmt noch heute davon“, beglückt mich das.
Auch für ältere Menschen, die nicht mehr ins Konzert gehen können, Musik zu ihnen zu bringen, sogar bis ins Hospiz, ist wertvoll. Musik in die Gesellschaft tragen, nicht nur im Konzertsaal – das ist unglaublich wichtig.
Das finde ich schön. Man baut Mauern ab, die Menschen vom Konzertbesuch abhalten könnten. Musik wird nahbar.
Genau. Als ich klein war, haben die Nachbarn meiner Eltern – zufällig Musiker – bei einem Straßenfest gespielt. Ich war fasziniert und begeistert. Das hat mir viel gegeben.
Wer schreibt hier eigentlich..?
Patrick Hinsberger studierte Jazz Trompete bei Matthieu Michel und Bert Joris und schloss sein Studium im Sommer 2020 an der Hochschule der Künste in Bern (Schweiz) ab.
Seit seiner Bachelor-Arbeit beschäftigt er sich intensiv mit dem Thema musikalisches Üben und hostet seit 2021 den Interview-Podcast "Wie übt eigentlich..?"
