Hilft langsames Üben wirklich – oder vergeuden wir damit nur Zeit?
Diese Frage stellen sich nicht nur Musikschüler:innen, sondern auch erfahrene Profis. Der Musikpsychologe Prof. Dr. Clemens Wöllner hat gemeinsam mit einer Doktorandin eine groß angelegte Studie mit über 250 Musiker:innen durchgeführt – von ambitionierten Hobbymusiker:innen bis hin zu Profis. Das Ergebnis: Langsames Üben ist extrem verbreitet, aber es wirkt nicht in jeder Situation gleich.
In diesem Artikel erfährst du,
- welche Vorteile des langsamen Übens wissenschaftlich belegt sind,
- wie Slow Practice deine Technik, dein Timing und deine musikalische Ausdruckskraft verbessert,
- warum viele Musiker:innen beim mentalen Üben unbewusst schneller werden – und wie du mit dem richtigen Tempo gegensteuerst,
- und wie dir Konzepte wie Cognitive Load und selbstreguliertes Lernen helfen können, deine Übezeit effektiver zu gestalten.
Ob du gerade ein neues Stück einstudierst, an deiner Technik feilst oder nach Wegen suchst, deinen Flow beim Musizieren zu finden – hier bekommst du praxisnahe Tipps und wissenschaftlich fundierte Impulse, wie du langsames Üben sinnvoll, motivierend und erfolgreich einsetzen kannst.
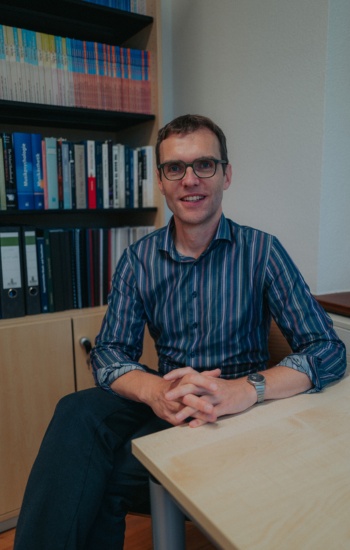
Das Interview mit Clemens Wöllner
Die erste Frage, mit der es immer losgeht, lautet: Vervollständigen Sie folgenden Satz. Üben heißt für Sie?
Konzentriert Zeit verbringen mit dem Instrument oder der Stimme und einen guten Wechsel hinzubekommen zwischen dem Fokus auf etwas sehr Spezielles, das man verbessern möchte, und gleichzeitig den Blick für das große Ganze nicht zu verlieren – also das ganze Musikstück im Blick zu behalten. So entsteht ein guter Wechsel zwischen dem Speziellen und dem Ganzen.
Sehr spannend, da werden wir auf jeden Fall später noch einmal drauf eingehen. Gibt es aktuell eine Musik, die bei Ihnen in Dauerschleife läuft?
Dauerschleife so gut wie nie bei mir, weil ich auch die Stille sehr schätze. Wenn ich Musik höre, mache ich das konzentriert und kaum im Hintergrund. Ich höre sehr gern französische Musik um die Jahrhundertwende – César Franck, Maurice Ravel – sie sprechen mich sehr an. Außerdem mag ich den Experimentalisten Nik Bärtsch, den ich vor einiger Zeit entdeckt habe.
Ich mag auch gut gemachte Popmusik. Es ist ein großes Spektrum und hängt immer von der Situation ab, ob ich bewusst zuhöre – was meist der Fall ist, wenn ich Musik höre.
Entweder-Oder-Fragen
Um den Zuhörerinnen und Zuhörern Sie etwas näher vorzustellen, habe ich ein paar Entweder-Oder-Fragen. Sie haben einen Joker – bei einem dürfen Sie „weiter“ sagen.
Konzert oder gemütlicher Musikabend zu Hause?
Konzert.
Freiburg oder Hamburg?
Freiburg, ganz klar. Ich bin ja von Hamburg nach Freiburg gezogen.
Zeitreisen oder Zeit anhalten?
Zeit anhalten.
Warum?
Ich glaube nicht so ganz, dass Zeitreisen funktionieren.
Aber das andere schon?
Ja, das funktioniert. Das kann auch über Musik passieren – dass wir uns für einen Moment Zeit herausnehmen. Wenn Zeitreisen funktionieren würden, wäre das fast noch spannender.
Mit „anhalten“ meinen Sie das Ausdehnen von Zeit?
Genau – anhalten im Sinne von strecken, sodass wir in bestimmten Momenten die Zeit vergessen und außerhalb der Zeit zu sein scheinen.
Wenig und oft oder selten und viel?
Das sind Gegensätze in sich. Ich glaube, selten und viel – mit besonderer Intensität.
Routine oder Abwechslung?
Beides. Hier ist die Balance wichtig – ich kann mich nicht entscheiden.
Zeit und Üben – Parallelen aus der Forschung
Wir hatten das Zeitthema ja schon angeschnitten. Wenn ich Sie als Zeitforscher bezeichnen würde – lässt sich die Zeitwahrnehmung aufs Üben übertragen?
Absolut. Wir haben viele Studien zum langsamen Üben gemacht – dabei ist die Zeitfrage zentral. In der Forschung geht es darum, wie Zeit im Kleinen, also im Mikro-Timing, gestaltet wird, um bestimmte Aspekte hervorzuheben, und wie im Großen Spannungsbögen entstehen. Das ist relevant fürs Üben.
Es gibt auch Bezüge zu Konzepten wie Flow, bei dem wir das Hier und Jetzt vergessen. Wir haben die Zeitdehnung in der Wahrnehmung untersucht: Wenn Musik sehr komplex ist und viele Ereignisse hat, erscheint die Dauer im Rückblick länger – im Moment selbst vergeht sie aber schneller.
Wenn Sie diese großen Bögen und das Mikro-Timing ansprechen – gibt es schon konkrete Überträge aufs Üben?
Vieles ist noch Grundlagenforschung. Im mentalen Üben spielt Zeitwahrnehmung aber klar eine Rolle. In Studien haben wir festgestellt, dass Menschen beim mentalen Spielen die Dauer oft kürzer einschätzen als beim realen Spielen. In einer Untersuchung sollten Teilnehmende den Puls tappen, während sie sich das Spiel vorstellten – es war deutlich schneller als beim realen Spiel. Mentales Üben läuft also meist etwas schneller ab.
Nachteule oder Frühaufsteher?
Frühaufsteher.
Die perfekte Übezeit – gibt es sie?
Würden Sie sagen, es gibt wissenschaftlich gesehen die perfekte Übezeit für jeden von uns?
Individuell ja, aber das hat genau damit zu tun. Auch das haben wir einmal untersucht. Wir haben in Hamburg eine Studie zur Chronobiologie durchgeführt, bei der sich mein Doktorand David Hammerschmidt mit der Frage befasst hat, ob es Unterschiede in Zeitwahrnehmung, Zeitempfinden und im Tappen gibt, je nachdem, ob jemand eine „Eule“ oder eine „Lerche“ ist. Wir haben festgestellt: Menschen, die eher nachts sehr aktiv sind, brauchen morgens länger, um in die Gänge zu kommen, und geben früh langsamer einen Puls an, als sie es abends tun würden. Frühaufsteher hingegen bleiben den ganzen Tag über relativ gleich.
Das heißt, dass sich auch die optimalen Übezeiten nach der Chronobiologie jedes Einzelnen richten. Jeder hat also seine individuelle beste Zeit. Aus der Expertiseforschung wissen wir aber, dass für viele der Vormittag – bei einigen etwas früher, bei anderen etwas später – oft eine sehr produktive Phase ist. Eine weitere produktive Phase gibt es oft am Nachmittag. Das ist natürlich verallgemeinernd und hängt stark von individuellen Faktoren ab.
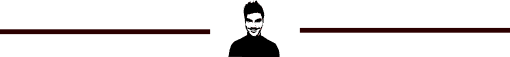

Melde dich für meinen High Five Newsletter an und erhalte 10 Übe-Tipps gratis!
Einmal im Monat nehme ich dich mit hinter die Kulissen meines Podcasts:
- Du erfährst exklusiv, wer meine nächsten Gäste sind.
- Du bekommst praxiserprobte Einblicke in das Thema Üben.
- Du erhältst handverlesene Bücher- und Musiktipps direkt auf dein Handy oder deinen Rechner.
Kurz, kompakt und kostenlos – genau die Inspiration, die du fürs tägliche Üben brauchst.
Nur aktuell: Als Dankeschön erhältst du meine 10 besten Übe-Tipps als kostenloses PDF direkt nach deiner Anmeldung!
Fragen stellen oder Fragen beantworten?
Fragen stellen.
Einsicht oder Weitsicht?
Einsicht.
Laut oder leise?
Leise.
Langsam oder schnell?
Langsam – das haben wir über viele Jahre untersucht. Aber ich muss sagen, schnell kann sehr viel Spaß machen, zum Beispiel beim Fahrradfahren oder bei virtuoser Musik.
Studie zum langsamen Üben
Die Frage war auch als sanfte Überleitung zu Ihrer Studie gedacht. Sie haben vor drei Jahren mit Ihrer Doktorandin Emma Allingham über 250 Antworten von Hobby- und Profimusiker*innen ausgewertet, die Fragen dazu beantwortet haben, wie sie langsames Üben in ihrem Übealltag nutzen. Was wären rückblickend die drei wichtigsten Erkenntnisse?
Zunächst einmal ist es spannend, dass fast alle langsam üben. Das ist etwas sehr Intuitives, das viele anwenden, aber über das wir kaum etwas wissen. Das war für mich ein Startpunkt der Forschung: Warum üben alle langsam, obwohl die Bewegungsabläufe oft völlig andere sind als im Aufführungstempo? Beim Gesang sind es zum Beispiel andere Muskelanspannungen und physiologische Vorgänge. Warum setzt man es ein, obwohl es wenig mit der eigentlichen Aufführungssituation zu tun hat?
Wir haben das in zwei Analysen untersucht: In der einen waren es etwa 250 Befragte, in der anderen über 360 aus mehr als 40 Ländern, verschiedenen Genres und Expertisegraden. Das Ergebnis: Alle haben langsam geübt.
Darüber hinaus gibt es ganz unterschiedliche Funktionen: technische Aspekte, Ausdrucksgestaltung, Aufwärmen. Langsames Üben kann auch helfen, Fehler zu vermeiden – es kann zur Strukturierung und Selbstregulation beitragen. Aber es ist nicht in allen Situationen hilfreich; manchmal kann es auch weniger positiv belegt sein.
Fehlervermeidung und kognitive Belastung
Ich fand spannend, was Sie zum Thema Fehlervermeidung gesagt haben. Ich mag das Wort nicht so, aber nennen wir es fehlerfreies Üben beim ersten Durchlauf eines neuen Stücks.
Genau – nicht im Sinne eines strikten „keine Fehler erlaubt“, sondern eher so, dass man die Parameter so einstellt – etwa durch Temporeduktion –, dass man gar nicht erst in Versuchung kommt, viele Fehler zu machen.
Sie hatten das methodisch mit der Cognitive Load Theory erklärt – weil Temporeduktion ein Faktor ist. Es gibt drei Faktoren: die extrinsische Cognitive Load, die intrinsische, die germaine und die extrinische.
Kognitive Belastung und Arbeitsgedächtnis
Die kognitive Belastung, wie wir sie auch nennen können, hängt damit zusammen, dass das Arbeitsgedächtnis eine begrenzte Kapazität hat. Vielen ist die berühmte Zahl „7“ aus den 1950er Jahren von Miller bekannt – diese gilt heute als überholt. Warum? Weil wir unterschiedliche Möglichkeiten haben, Informationen zu strukturieren. Wer Expertise in einem Bereich hat, kann komplexe Inhalte als eine Einheit (Chunk) wahrnehmen. So lassen sich mehrere solcher Einheiten im Arbeitsgedächtnis kombinieren.
Die kognitive Belastung steigt, wenn das Material komplexer wird – das ist die intrinsische Belastung, die mit dem Material selbst, etwa dem Musikstück, zusammenhängt. Es gibt aber auch die extrinsische Belastung, die durch zusätzliche Anforderungen wie Handlungsanweisungen entsteht. Wenn wir beispielsweise ein Stück plötzlich sehr schnell spielen, steigt die extrinsische Belastung. Reduzieren können wir sie durch langsames Üben, das Üben von Teilbereichen oder das Spielen mit nur einer Hand.
Möglichkeiten zur Reduktion der extrinsischen Belastung
In Ihrer Studie schreiben Sie, dass es hilfreich ist, die extrinsische kognitive Belastung zu verringern – etwa durch Temporeduktion –, um die germane cognitive load zu fördern. Was wäre außerhalb der Temporeduktion noch denkbar?
Das ist tatsächlich eine Herausforderung. Viele üben intuitiv bestimmte Abschnitte separat. Eine spannende Studie von Roger Chaffin und Gabriele Imre zeigte, dass eine Pianistin an verschiedenen Punkten im Stück ansetzte, bestimmte Merkpunkte setzte und kurze Segmente wiederholt übte. Das ist sehr effektiv.
Weitere Möglichkeiten: kürzere Sinneinheiten (Chunks) bilden, diese mit Merkpunkten versehen und auswendig lernen. Auch kann man den Rhythmus vereinfachen, um sich zunächst auf die richtigen Töne zu konzentrieren. Das liegt zwischen intrinsisch und extrinsisch, weil das Material verändert wird, es aber auch eine Handlungsanweisung darstellt.
Gibt es ein „Tempo Lento Giusto“?
Langsam ist nicht gleich langsam. Gibt es in Ihrer Studie einen Richtwert, ab wann ein Tempo als langsam gilt?
Nein, es gibt keinen festen Wert. Das hängt individuell vom Expertisegrad, der Komplexität des Stücks und dem Genre ab. In der Praxis wird oft das halbe Aufführungstempo gewählt – das kann hilfreich sein, weil die metrische Struktur erhalten bleibt. Bei sehr schnellen Stücken kann ein Tempo, das objektiv noch schnell wirkt, für Übezwecke bereits langsam sein. Entscheidend ist der Fokus der Übeeinheit: Für fehlerfreies Spielen wählt man ein Tempo, das dies ermöglicht. Für andere Ziele, wie das Einüben eines schwierigen Fingersatzes, kann ein höheres Tempo sinnvoll sein.
Individuelle Gestaltung des langsamen Übens
Spannend war auch zu sehen, wie unterschiedlich die TeilnehmerInnen Ihrer Studie langsames Üben einsetzen.
Ja, absolut. Manche nutzen es vor allem zur Aufwärmung, andere, um an expliziten Details wie Klangfarbe zu arbeiten. Die Beschreibungen waren sehr individuell.
Kombination von langsamem und schnellem Üben
Wir hatten auch mögliche Gefahren des langsamen Übens angesprochen. Gibt es Hinweise darauf, wie man langsames und schnelles Üben kombinieren kann? Mir fällt da das 1:2-Verhältnis von Eckart Altenmüller ein – halb so schnell üben, dann im doppelten Tempo spielen.
Das ist ein interessanter Ansatz. Altenmüller erklärt, dass schnelle und langsame Bewegungen in unterschiedlichen Gehirnarealen verarbeitet werden. Ab einem gewissen Punkt kann man Bewegungen nicht mehr schneller ausführen, ohne das Bewegungsprogramm zu wechseln – ähnlich wie beim Gehen und Laufen. Deshalb kann es sinnvoll sein, gezielt zwischen sehr langsamem Tempo und Endtempo zu wechseln. Das kann sich auch mit Methoden wie dem Chunking verbinden lassen. In unserer Forschung spielt diese Kombination eine Rolle, aber es gibt noch keine festen Verhältnisse, die sich universell empfehlen lassen.
Das schnelle Üben, also im angeschriebenen Tempo, ist auf jeden Fall wichtig. Beim mentalen Üben gibt es oft zeitliche Abweichungen. In der Leimer-Gieseking-Schule gibt es Anekdoten, dass allein durch mentales Üben ein Stück aufführungsreif werden kann – wenn man es wirklich sehr gut beherrscht. Beim langsamen Üben würde ich das nicht behaupten. Wer ein Stück nur langsam geübt hat, ist bei virtuosen Werken vermutlich nicht ausreichend vorbereitet. Ein klares prozentuales Verhältnis zwischen langsamem und schnellem Üben würde ich nicht empfehlen. Eine große Vielfalt an Strategien halte ich für entscheidend: Langsames Üben ist besonders am Anfang sinnvoll – für fehlerfreies Spiel, Frustreduktion, Überblick über das Stück – und später für die Bewusstmachung bestimmter Abläufe und musikalischer Ausdrucksideale.
Bewusstmachung durch Zeitlupe
Was meinen Sie mit Bewusstwerden zwischendurch?
Viele Abläufe sind automatisiert. Langsames Üben kann helfen, zu überprüfen, ob das, was motorisch geschieht, auch dem entspricht, was ich innerlich als Klangvorstellung habe. Im verlangsamten Tempo kann man wie mit einem Vergrößerungsglas auf Details schauen – räumlich und zeitlich. Das gibt mehr Zeit für die Wahrnehmung und erlaubt eine höhere „Auflösung“ musikalischer Ereignisse.
Manchmal passiert es, dass man bei automatisierten Passagen plötzlich darüber nachdenkt, wie man sie eigentlich spielt – und dann funktionieren sie nicht mehr. Wäre das ein Fall von Bewusstmachung, bei dem das Bewegungsprogramm noch nicht vollständig gefestigt ist?
Ja, das könnte sein. Üben soll genau diese bewusste Steuerung fördern, um das interpretatorische Ideal zu erreichen. Manchmal ist etwas überübt und entspricht nicht mehr der ursprünglichen Intention.
Grenzen und Gefahren des langsamen Übens
Sie hatten erwähnt, dass langsames Üben auch Nachteile haben kann. Was wären typische Beispiele?
Erstens: Es kann langweilig sein. Zweitens: Man kann sich in Details verlieren. Drittens: Bei sehr langsamem Üben unterscheidet sich die Motorik stark vom Spiel im Originaltempo. Wer zu selten im realen Tempo übt, riskiert, dass motorische und ausdrucksgestalterische Ziele nicht eins zu eins übertragbar sind.
Interessant ist, dass kaum jemand empfiehlt, schneller als das ZieltTempo zu üben.
Ja, das ist bemerkenswert. Eine Ausnahme wäre als Absicherung: etwa wenn im Konzert ein Stück schneller gezählt wird, als geplant. So weiß man, dass man auch 10 BPM schneller noch spielen kann. Das kann sinnvoll sein, um in Live-Situationen flexibel zu bleiben.
Langsames Üben ist also nur ein Baustein. Gibt es sinnvolle Kombinationen mit anderen Methoden?
Ja. Variationsreiche Übungen – wechselndes Tempo, unterschiedliche Artikulationen, Fokus auf Teilabschnitte, mentalem Üben – können sich gegenseitig ergänzen. Entscheidend ist, dass der Methodenmix auf das jeweilige Ziel der Übeeinheit abgestimmt wird.
Chunking und Segmentierung im Übeprozess
Das Chunking – also das Einteilen in Abschnitte oder Segmente – haben wir bereits angesprochen. In der erwähnten Studie von Chaffin und Imre wurde der gesamte Übeprozess vom ersten Ansehen des Stücks bis zur Aufführung genau analysiert. Dabei stellte sich heraus, dass oft eine gezielte Auswahl bestimmter Abschnitte immer wieder geübt wird. Dieses Segmentieren ist eine häufig genutzte Methode, die sich gut kombinieren lässt: Einige Abschnitte werden langsam geübt, andere im Originaltempo. Anschließend kann man die Rollen tauschen, sodass vormals schnelle Abschnitte langsam und langsame schnell gespielt werden.
Eine weitere Variante ist die rhythmische Variation: Ein komplexes Stück einmal in gleichmäßigen Vierteln spielen, Punktierungen umkehren oder andere rhythmische Veränderungen vornehmen. Auch dies lässt sich mit langsamem Üben kombinieren. Interessant ist, dass eine scharfe Punktierung im langsamen Tempo oft ganz anders wirkt als im ZieltTempo.
Die Studie zum italienischen Konzert
Die Studie von Roger Chaffin und Gabriele Imre zum italienischen Konzert von Bach – konkret dem Presto – wurde über zehn Monate wissenschaftlich begleitet. Dabei wurde die Übestruktur detailliert untersucht. Sie haben die Chunks schon erwähnt. Wie verhalten sich diese zu den sogenannten Performance Cues?
Performance Cues oder Hinweisreize sind Punkte im Musikstück, die beim Auswendiglernen, Merken und Strukturieren helfen. Gabriele Imre setzte oft an solchen Punkten erneut an – etwa bei einer neuen Phrase oder dem Beginn einer Seite. Diese Hinweise können musikalisch, strukturell oder visuell sein. Die Chunks sind meist kleinere Einheiten – zwei oder vier Takte – die wiederholt geübt werden.
Wenn ich meinen Studierenden diese Diagramme aus den Studien zeige, die wie Barcodes aussehen, sind sie oft erstaunt, wie häufig einzelne Passagen – 20, 30 oder 40 Mal – wiederholt werden. Manche bevorzugen andere Strategien, etwa mentales Üben, statt permanenter Wiederholung. Doch wer das eigene Übeverhalten aufzeichnen würde, würde vermutlich ähnliche Muster feststellen.
Methodenvielfalt und mentale Hürden
Die Studie ist schon etwas älter. Heute würde man wahrscheinlich mehr Methodenvielfalt einsetzen. Aber oft packt einen doch der Ehrgeiz und man wiederholt lieber zehn Mal, bevor man über Alternativen nachdenkt.
Ja, kurzfristig erfordert es kognitive Ressourcen, erst eine andere Methode zu überlegen. Hat man diese Vielfalt aber verinnerlicht, wird sie selbstverständlich. Es braucht oft eine gewisse Überwindung – ähnlich wie beim mentalen Üben, das vielen zunächst schwerfällt, weil Spielen mehr Spaß macht. Langsames Üben ist dagegen seit dem Instrumentenlernen für viele eine gewohnte Methode.
Spannend fand ich auch den hohen Stellenwert, den Imre am Anfang auf das Strukturieren und Planen des Stücks legt, um später Chunks und Performance Cues gezielt zu nutzen.
Absolut. Das ist ein zentrales Ergebnis. Sie setzte bewusst Merkpunkte – sogenannte Retrieval Points – und verfolgte klare musikalische Intentionen.
Ist langsames Üben ein Wundermittel?
Wenn Sie auf die Studie zurückblicken: Hat sich der Ruf des langsamen Übens als Wundermittel bestätigt?
Die Schlussfolgerung ist: Langsames Üben ist extrem verbreitet – genresübergreifend und in allen Karrierestadien, gerade im Klassikbereich. Es ist keineswegs nur etwas für Anfänger. In populären Genres nimmt die Häufigkeit mit steigender Expertise etwas ab, möglicherweise weil das Üben insgesamt weniger Gewicht erhält.
Wir haben versucht, über Selbstaussagen die Qualität und Funktion des langsamen Übens zu erfassen. Der nächste Schritt wäre, experimentell zu erforschen, welche Instruktionen oder Tempi besonders hilfreich sind. Ob es das Allheilmittel ist, weiß ich nicht. Aber wir wissen heute, dass es – gerade in Verbindung mit Informationsdichte und kognitiver Belastung – entscheidende Vorteile bieten kann.
Flow im Kontext des Übens
Wir hatten ja vorher schon das Konzept Flow angesprochen. Kennen Sie die Arbeit von Andreas Burzik, der sieben Funktionen beschreibt, die nötig sind, um beim Üben in einen Flow-Zustand zu gelangen? Notwendig sind für ihn: Klarheit der Ziele, Konzentration auf ein begrenztes Feld und das Verhältnis von Anforderungen zu Fähigkeiten. Fakultativ sind: Gefühl von Kontrolle, Mühelosigkeit des Handlungsablaufs, Veränderung des Zeiterlebens, Verschmelzen von Handlung und Bewusstsein. Interessant ist, dass „langsam“ hier gar nicht vorkommt. In Ihrer Studie zeigte sich aber, dass langsames Üben bei vielen zu einer Art Flow-Zustand führt, oder?
Ja, besonders wenn ein Stück neu erarbeitet wird, können die Anforderungen etwas reduziert werden. Das entspricht dem ursprünglichen Flow-Konzept von Csikszentmihalyi, das die Balance zwischen Anforderungen und Fähigkeiten betont. Sind die Anforderungen zu gering, kann es langweilig werden – was bei sehr langem, langsamen Üben durchaus vorkommen kann. Langsames Üben sensibilisiert aber auch für die zeitliche Komponente, sowohl in der Fremd- als auch in der Selbstwahrnehmung. Flow muss nicht nur durch hohe Tempi entstehen – er kann auch auftreten, wenn wir uns auf Klangfarbe oder gestalterische Details konzentrieren und merken, dass es funktioniert, vielleicht gerade weil wir das Tempo reduziert haben.
Grenzen des Flow-Konzepts in der Musik
Sie haben mir im Vorgespräch die Frage mitgegeben, ob es Grenzen des Flow-Konzepts für die Musik gibt. Würden Sie sagen, es gibt solche Grenzen?
Ja, auf jeden Fall. Bisher galt für Flow-Erlebnisse in verschiedenen Bereichen die Zeitvergessenheit als konstitutiv – man ist aus dem Hier und Jetzt herausgenommen und geht ganz in der Tätigkeit auf. In der Musik ist Flow für viele sehr erstrebenswert und eine wichtige Motivation, Höchstleistungen zu erbringen. Gleichzeitig müssen wir in der Musik zeitlich extrem exakt und kontrolliert arbeiten. Dieses Spannungsfeld – einerseits aus der Zeit herausgenommen, andererseits präzise Zeitkontrolle – ist faszinierend und erfordert weitere Forschung.
Das geht ja fast schon in eine philosophische Richtung: einerseits die exakte musikalische Zeit im Stück, andererseits die subjektive Wahrnehmung der vergehenden oder stillstehenden Zeit.
Genau. Im Flow-Konzept ist damit gemeint, dass man das Zeitgefühl verliert. In der Musik jedoch haben wir oft eine geschärfte Wahrnehmung – wir reagieren auf zeitliche Abweichungen, vor allem im Ensemble. Solche Situationen werden trotzdem als Flow beschrieben, auch wenn die Zeitverzerrung nicht in vollem Maße eintritt. Vollständig „aus der Zeit zu fallen“ wäre der Musik sogar abträglich, da wir die Zeitgestaltung aktiv kontrollieren müssen.
Forschungsausblick
Wir behalten die Forschung hier also im Auge – sowohl zum Flow als auch zum langsamen Üben. Wäre es nicht spannend, das nicht nur qualitativ, sondern auch experimentell in der Übesituation zu begleiten?
Absolut. Das Flow-Thema interessiert mich sehr, ebenso wie die Frage, wie sich langsames Üben praktisch ausformt.
Outro
Zum Abschluss stelle ich allen meinen Gästen zwei Fragen: Was üben oder lernen Sie gerade, was Sie noch nicht so gut können?
Es gibt da dieses Stück aus den Goyescas von Granados, das abschnittsweise technisch machbar erscheint, aber es ist einfach zu vertrackt, das alles zusammenzubekommen. Vielleicht bekomme ich das irgendwann hin.“
Wenn Sie an Ihre eigene Studienzeit denken, aber auch an Ihre heutigen Studierenden – vor allem Musikstudierende – gibt es einen Tipp, den Sie gerne früher gehabt hätten?
Ja. Ich habe erst nach und nach viele interessante Ansätze kennengelernt. Von Anfang an mehr über die Vielfalt wissenschaftlicher Erkenntnisse zu wissen, wäre hilfreich gewesen. Mentales Üben hat mich schon im Studium fasziniert, spielte im Instrumentalunterricht aber keine Rolle. Der Transfer wissenschaftlicher Erkenntnisse in die Praxis wäre sehr wertvoll gewesen.
Das finde ich sehr schön. Herr Wöllner, haben Sie ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit.
Sehr gerne, es hat Spaß gemacht.
Wer schreibt hier eigentlich..?
Patrick Hinsberger studierte Jazz Trompete bei Matthieu Michel und Bert Joris und schloss sein Studium im Sommer 2020 an der Hochschule der Künste in Bern (Schweiz) ab.
Seit seiner Bachelor-Arbeit beschäftigt er sich intensiv mit dem Thema musikalisches Üben und hostet seit 2021 den Interview-Podcast "Wie übt eigentlich..?"
